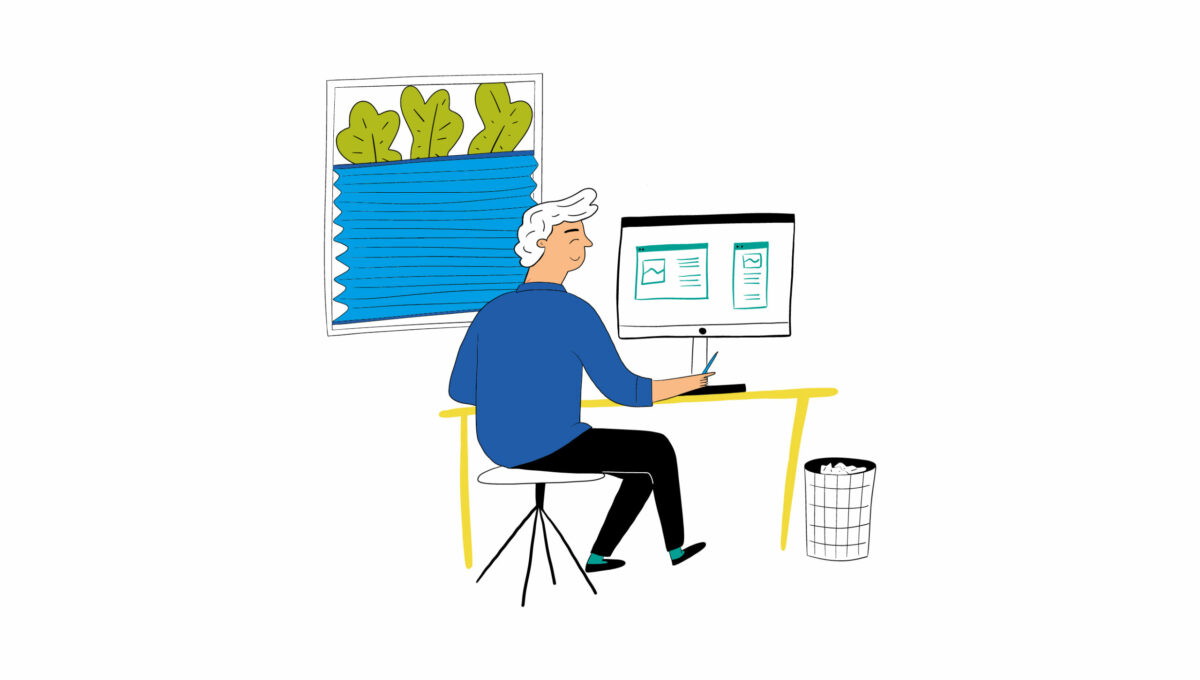Allgemeine Infos zu Energiearmut
Auf dieser Seite finden Sie allgemeine Infos zu Energiearmut, ihre Ursachen und Auswirkungen, sowie aktuelle Zahlen und Fakten für Österreich und Europa.

Was ist Energiearmut?
Der Begriff „Energiearmut“ taucht seit vielen Jahren immer wieder in öffentlichen Debatten rund um die Leistbarkeit von Energie auf. Meistens meint man damit die Nicht-Leistbarkeit oder Unerschwinglichkeit von Haushaltsenergie (z.B. Strom, Gas oder Fernwärme) – also dass Haushalte ihren notwendigen Energiebedarf nicht oder nicht ausreichend mit ihren vorhandenen finanziellen Mitteln decken können.
Die Ursachen für Energiearmut sind vielfältig. Hohe oder steigende Energiekosten, geringe Einkommen, längere Krankheit oder Arbeitslosigkeit, ein Wohnsitz mit schlechter Bausubstanz oder veralteten Geräten… all das sind Gründe, weshalb Haushalte von Energiearmut betroffen sein können.
Energiearmut kann sich in den betroffenen Haushalten auf viele verschiedene Arten zeigen: zum Beispiel, wenn Haushalte ihre Energierechnungen nicht oder nicht rechtzeitig zahlen können, wenn sie nicht in der Lage sind ihre Wohnung angemessen warm zu halten, oder auch, wenn sie nicht über die Ressourcen verfügen, um alte, ineffiziente oder kaputte Haushaltsgeräte auszutauschen.
Mit Energiearmut gehen viele weitere Herausforderungen einher. Angefangen bei gesundheitlichen Problemen (z.B. aufgrund von zu kalten oder feuchten Wohnräumen, aber auch bei fehlendem Schutz vor Hitze), über Stress und Stigmatisierungserfahrungen bis hin zu schlechteren Bildungschancen und sozialer Ausgrenzung. Darum ist es wichtig, Energiearmut präventiv zu vermeiden und dort, wo sie bereits existiert, Betroffene gezielt zu unterstützen.
Wie sich Energiearmut im Leben von Betroffenen zeigt und welche Ursachen dahinterstehen, zeigt auch der Faktencheck Energiearmut der kea. Dieser Faktencheck liefert Antworten auf die häufigsten und wichtigsten Fragen zu Energiearmut.
Aktuelle Zahlen
Laut aktuellsten EU-SILC Daten von 2024 können sich etwa 4% der Befragten in Österreich nicht leisten, ihre Wohnung angemessen warmzuhalten. Das sind etwa 358.000 Personen. Besonders betroffen sind arbeitslose Menschen (18%), Menschen in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität (15%), armutsgefährdete Menschen (11%), Menschen in Wien (8%) und anderen Städten mit über 100.000 Einwohner:innen (5%), Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft (9%), mit Pflichtschulabschluss (8%), Einelternhaushalte (7%) und alleinlebende Pensionistinnen (6%).
Armutsgefährdete Haushalte haben besondere Herausforderungen hinsichtlich ihrer Wohnsituation: 36 % von ihnen müssen mehr als 40 % ihres Einkommens für Wohnen ausgeben, 19 % berichten von Schimmel oder Feuchtigkeit und 14 % haben Rückstände bei Wohnnebenkosten. Sie wohnen zudem überwiegend zur Miete – nur 27% der armutsgefährdeten Haushalte leben im Eigentum.
Zusätzlich gaben in aktuellsten Quartalserhebungen der Statistik Austria 30,3% der Haushalte an, dass sie sich im vorherigen Quartal zwar die für ihren Haushalt benötigte Energie leisten konnten, aber nur, weil sie den Verbrauch verringert haben.
Auf EU-Ebene waren 10,6% der Haushalte 2023 nicht in der Lage, ihre Wohnung angemessen warmzuhalten. Der Anteil in österreichischen Haushalten von 4% lag somit unter dem europäischen Durchschnitt.
Um Energiearmut in Österreich in Zukunft noch ausführlicher und effektiver zu analysieren, hat die kea gemeinsam mit Expert:innen aus verschiedenen Organisationen ein Monitoringkonzept erarbeitet. Es bietet ausführlichere Informationen über relevante Indikatoren und Datenquellen zur Messung von Energiearmut.