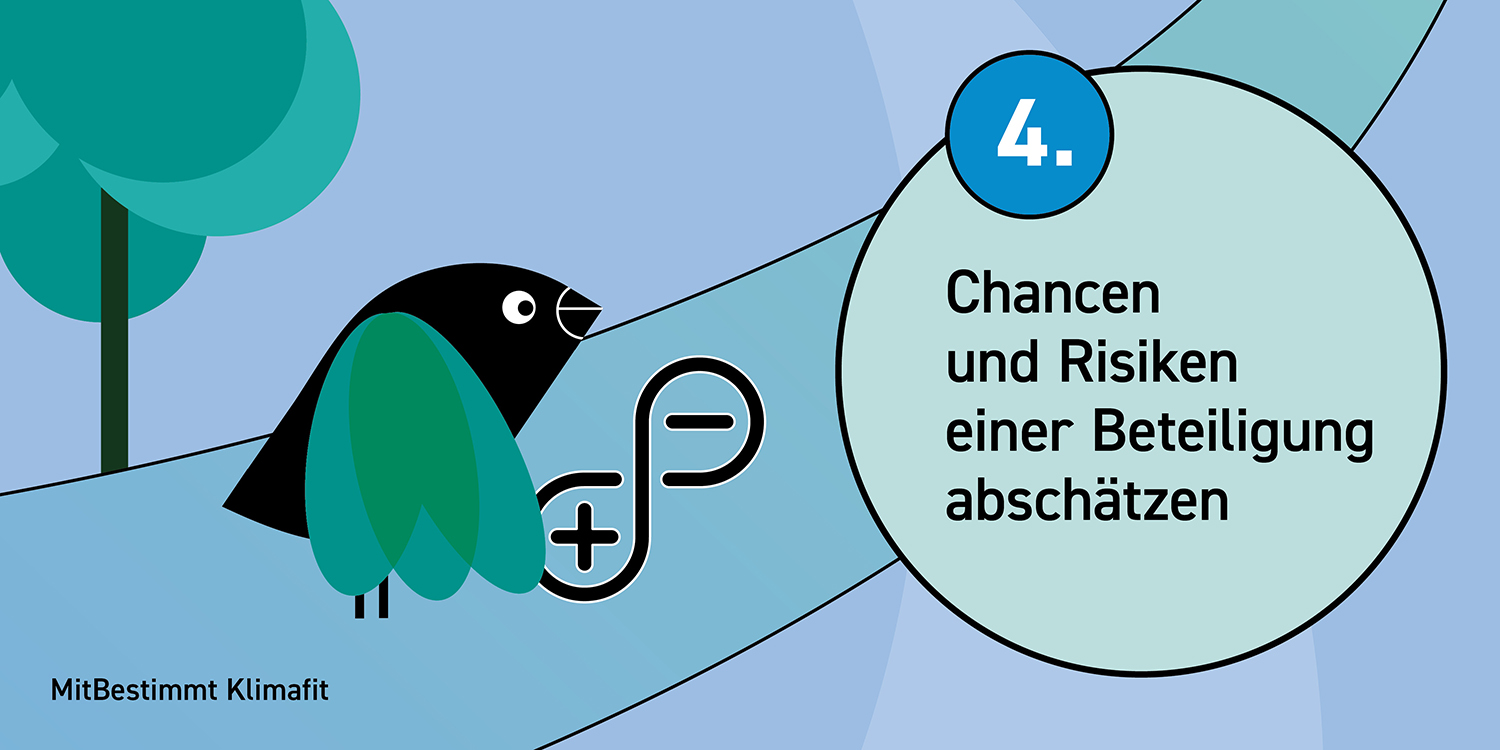4. Chancen und Risiken einer Beteiligung abschätzen
Nachdem Sie die Lage eingeschätzt und Ihre Handlungsoptionen geprüft haben, stellt sich die wichtige Frage, ob eine Bürger:innenbeteiligung bei Ihrem Vorhaben sinnvoll ist. Eine Überprüfung, ob bzw. in welchem Ausmaß die nachfolgenden Punkte auf Ihr Vorhaben zutreffen, hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage.
Wichtig dabei ist, dass Sie die Chancen und Risiken nicht nur aus Ihrer eigenen Rolle heraus beurteilen, sondern sich auch in die Rolle anderer relevanter Akteur:innen aus zum Beispiel der Bevölkerung, der Politik, der Verwaltung oder von Projektwerber:innen versetzen und auch überlegen, welche Folgen eintreten könnten, wenn es keine Beteiligung gibt (siehe ÖGUT 2004).
4.1 Was könnte für eine Beteiligung sprechen?
Allgemein
- Relevante Informationen werden zugänglich(er).
- Durch die Argumente und Sichtweisen verschiedener Akteur:innen (Faktenwissen, Erfahrungswissen) entsteht ein Wissenszuwachs, der zu besseren Ergebnissen und Lösungen führt. Vor allem das lokale Wissen von Anrainer:innen bereichern den Prozess.
- Es entsteht ein geordneter Rahmen für die Bearbeitung von Konflikten und den Ausgleich unterschiedlicher Interessen.
- Die Ergebnisse werden eher von der Bevölkerung akzeptiert.
- Die Kompetenz für zukünftige Aushandlungen erhöht sich bei allen Beteiligten.
- Es entstehen persönliche Beziehungen, die in Zukunft für alle Beteiligten von Vorteil sind.
- Jede:r Beteiligte kann Anerkennung und Sympathie gewinnen.
Aus Sicht der Politik
- Die Akzeptanz politischer Entscheidungen wird erhöht.
- Die Bürger:innen gewinnen mehr Vertrauen in die Politik.
- Der Erwartungsdruck und das Lobbying vonseiten einzelner Interessengruppen nimmt ab.
- Das Image der Politiker:innen steigt durch mehr Bürger:innennähe.
- Die Kommunikation mit den Bürger:innen und den Interessenvertreter:innen verbessert sich.
- Minderheiten können sich besser in die Diskussion einbringen.
Aus Sicht der Verwaltung
- Divergierende Interessen können leichter eingeschätzt und zusammengeführt werden.
- Durch schnellere Behördenverfahren (weniger Stellungnahmen und Einsprüche, weniger nachträgliche Beschwerden) wird die Verwaltung entlastet.
- Der Erwartungsdruck und das Lobbying vonseiten einzelner Interessengruppen nimmt ab.
- Der politische Druck auf einzelne Mitarbeiter:innen in der Verwaltung kann reduziert werden.
- Themen, die über klassische Verwaltungsaufgaben hinausgehen, diese aber mitunter beeinflussen, können diskutiert werden.
Aus Sicht von Bürger:innen und Bürger:inneninitiativen
- Eigene (Wert-)Vorstellungen, Ideen, Interessen und lokales Wissen können eingebracht und umgesetzt werden.
- Projekte, Pläne, Programme und politische Maßnahmen können mitgestaltet werden.
- Status und Gewicht der eigenen Organisation nehmen zu.
- Es entsteht eine Vertrauensbasis für künftige Kooperationen.
- Die Einsicht in den Entscheidungsprozess wird erhöht.
- Minderheiten können sich besser in die Diskussion einbringen und deren Interessen werden beachtet.
Aus Sicht von Projektwerber:innen
- Das Vorhaben wird in der Gemeinde und der Region eher akzeptiert.
- Das unternehmerische Risiko wird verringert, es entsteht größere Rechtssicherheit.
- Die Chance auf eine raschere Realisierung von Projekten steigt, weil seltener Rechtsmittel ergriffen werden und es weniger nachträgliche Beschwerden gibt.
- Es kann eine Vertrauensbasis für künftige Kooperationen (auch zu den Produkten und Dienstleistungen oder Leistungen eines Betriebes) entstehen.
- Das Image der Projektwerber:innen in der Gemeinde/Region kann verbessert werden.
4.2 Was könnte gegen eine Beteiligung sprechen?
Allgemein
- Die Ziele der Beteiligung sind nicht ausreichend definiert.
- Es besteht kein ausreichender Verhandlungsspielraum.
- Die Beteiligten können keinen ausreichenden Nutzen für sich erkennen.
- Die Beteiligten sind nicht bereit zu kooperieren.
- Es ist nicht sicher, dass die Ergebnisse auch tatsächlich umgesetzt werden können.
- Es stehen keine ausreichenden Ressourcen (Zeit, Geld) zur Verfügung.
- Es gibt negative Erfahrungen mit Bürger:innenbeteiligung. Diesbezüglichen Vorbehalten können Sie jedoch durch eine gute Planung und kompetente Durchführung des Beteiligungsprozesses entgegenwirken.
- Die Aushandlungspartner:innen können nicht an einen Tisch gebracht werden.
Aus Sicht der Politik
- Befürchtungen über den Verlust von Kontrolle über das Vorhaben. Es bestehen Unsicherheiten darüber, wie das Verfahren abläuft und was danach mit den Ergebnissen geschieht. Diesen Befürchtungen kann durch eine frühe Einbindung und den Austausch mit der Politik entgegengewirkt werden.
- Ein Beteiligungsprozess kann den Entscheidungsprozess verlängern.
Aus Sicht der Verwaltung
- Befürchtungen über die Einschränkung bestehender Handlungsspielräume.
- Es bestehen Unsicherheiten darüber, wie das Verfahren abläuft und was danach mit den Ergebnissen geschieht.
- Ein Beteiligungsprozess kann den Entscheidungsprozess verlängern und zu einem zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Verwaltung führen.
- Befürchtung einer Vorbildwirkung und, dass die Bürger:innen dann in alle Entscheidungen einbezogen werden wollen.
Aus Sicht von Bürger:innen und Bürger:inneninitiativen
- Die Betroffenen fühlen sich nicht in der Lage, ihre Interessen gegenüber den Projektwerber:innen, der Verwaltung, den Gutachter:innen und anderen Beteiligten gleichwertig zu artikulieren. Ein unfaires Beteiligungsangebot (Scheinbeteiligung) führt zu einer Vereinnahmung.
- Es gibt bessere Alternativen als ein Beteiligungsverfahren, um die eigenen Interessen durchzusetzen.
- Die Betroffenen verfügen über keine ausreichenden Ressourcen für die Beteiligung (Zeit, Geld).
Aus Sicht von Projektwerber:innen
- Es kann zu Verzögerungen im Projektablauf kommen.
- Es können Mehrkosten durch einen zusätzlichen Arbeitsaufwand entstehen.
- Es bestehen Unsicherheiten darüber, wie das Verfahren abläuft und was danach mit den Ergebnissen geschieht.
4.3 Welche Nachteile könnten entstehen, wenn es keine Beteiligung gibt?
Allgemein
- Die relevanten Informationen bleiben nur einem kleinen Kreis vorbehalten, vorhandenes Wissen bleibt ungenutzt.
- Konflikte können eskalieren, da Betroffene das Gefühl haben, dass ihre Interessen nicht ernst genommen werden.
- Die Planungsergebnisse werden weniger akzeptiert.
- Bei zukünftigen Vorhaben muss wieder bei null begonnen werden.
Für die Politik
- Politische Entscheidungen werden weniger akzeptiert.
- Die Bürger:innen verlieren das Vertrauen in die Politik.
- Einzelne Interessengruppen können verstärkt lobbyieren.
- Das Image der Politiker:innen erleidet Einbußen durch mangelnde Bürgernähe.
- Die Kommunikationsbasis mit den Bürger:innen verschlechtert sich.
Für die Verwaltung
- Die Zusammenführung und Abwägung divergierender Interessen wird erschwert.
- Vermehrte Einsprüche, Stellungnahmen und nachträgliche Beschwerden führen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand und zu einer längeren Verfahrensdauer.
- Einzelne Interessengruppen können verstärkt lobbyieren.
- Der Druck seitens der Politik auf einzelne Beamt:innen wird größer.
- Impulse für eine bürgernahe Verwaltung bleiben aus.
Für Bürger:innen und Bürgerinitiativen
- Die Möglichkeiten, eigene (Wert-)Vorstellungen, Ideen und Interessen in einem geordneten Rahmen einzubringen, gehen verloren.
- Die Organisation kann sich nicht als kooperative Partnerin etablieren.
- Das Misstrauen im Hinblick auf zukünftige Kooperationen steigt.
- Entscheidungsprozesse können schwerer nachvollzogen werden.
- Es müssen andere Formen gefunden werden, die eigenen Interessen zu artikulieren (Aktionismus, Protest, Einschaltung der Medien etc.).
Für die Projektwerber:innen
- Die Akzeptanz des Vorhabens bei den Betroffenen sinkt.
- Die Rechtssicherheit nimmt ab, das unternehmerische Risiko steigt.
- Häufigere nachträgliche Beschwerden und die verstärkte Nutzung von Rechtsmitteln können zu einer Verzögerung des Vorhabens führen.
- Das Image der Projektwerber:innen in der Gemeinde und der Region verschlechtert sich.
4.4 Beteiligungsbeispiel: Ein klimafitter Hauptplatz
Die Leiterin des Umweltamtes stimmt sich im Detail mit dem Leiter des Bauamtes ab und holt Angebote zu den Modulen Freiraumplanung, Verkehrsplanung und Prozessbegleitung ein. Den Zuschlag erhält eine Bieter:innengemeinschaft bestehend aus einem Landschaftsplanungsbüro und einem Verkehrsplanungsbüro, in dem auch eine Prozessbegleiterin mit langjähriger Beteiligungserfahrung tätig ist.
Im Startgespräch mit den beauftragten Büros berichten die Leiterin des Umweltamtes und der Leiter des Bauamtes über die Ausgangslage und die Aufgabenstellung. Da die Gemeinde bisher wenig Erfahrung mit Bürger:innenbeteiligung hat, ist die Fragenliste bei diesem Thema besonders lang.
In einem eigenen Termin gehen die Leiterin des Umweltamtes, die Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit und die Prozessbegleiterin die Liste der Betroffenen durch und überlegen, welche Vor- und Nachteile diesen durch die klimafitte Neugestaltung des Platzes entstehen könnten. Die Leiterin des Umweltamtes weist auf einige wenige Geschäftsinhaber:innen und Anrainer:innen am Hauptplatz hin, mit denen es immer wieder Schwierigkeiten gibt.
Die Prozessbegleiterin wird ersucht, binnen drei Wochen einen konkreten Vorschlag für das weitere Vorgehen und die Kommunikation des Vorhabens nach außen zu erstellen. Währenddessen recherchieren die Leiterin des Umweltamtes und der Finanzverantwortliche, welche Fördermöglichkeiten es gibt und wie das Vorhaben konfiguriert werden müsste, damit eine möglichst hohe Fördersumme lukriert werden kann.