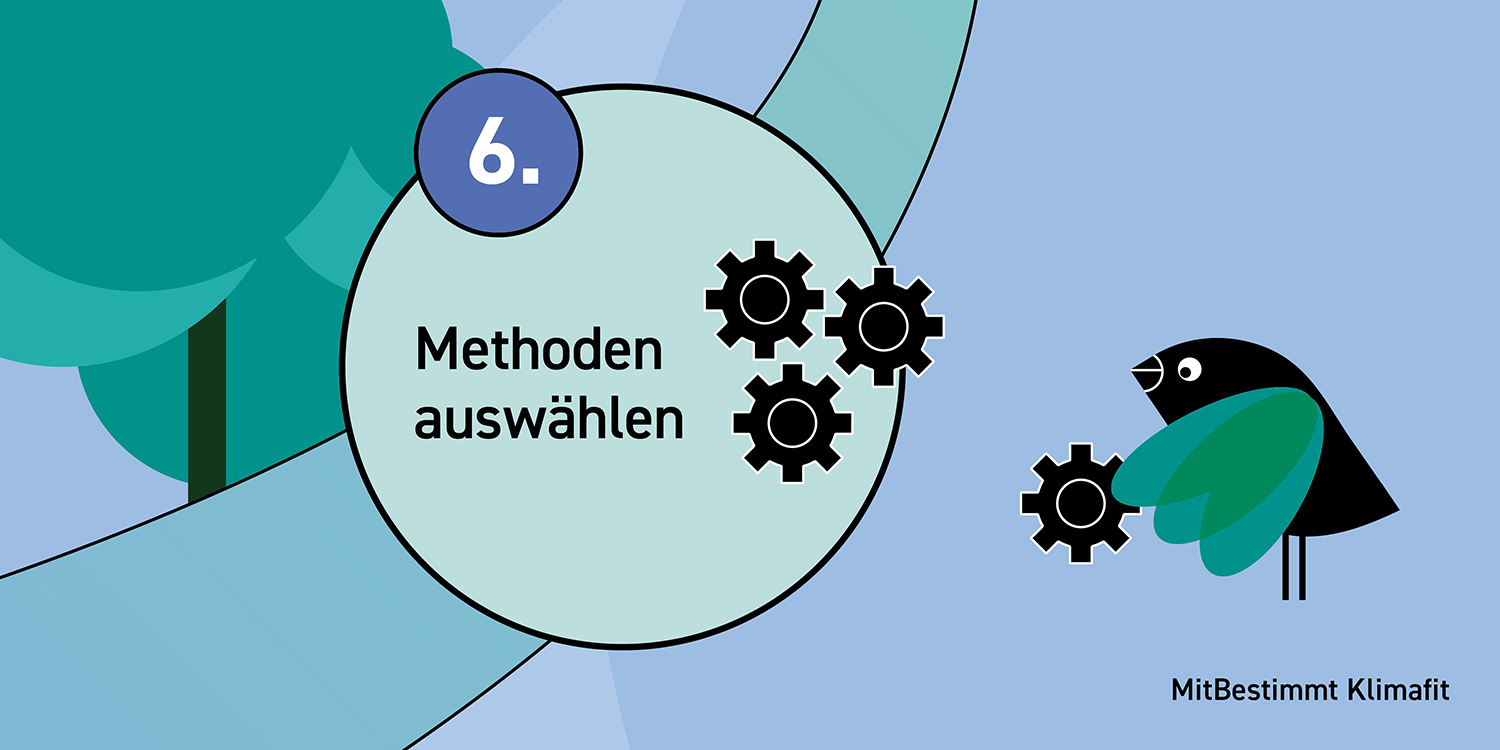6. Methoden auswählen
Sie haben im vorangegangenen Schritt wesentliche Punkte geklärt: die Ziele der Beteiligung, den Beteiligungsgegenstand, wer am Prozess beteiligt werden soll und die Beteiligungsstufe. Daraus ergeben sich erste Hinweise, welche Methoden für Ihren Prozess infrage kommen.
Bevor Sie sich für eine Methode oder einen Methodenmix entscheiden, lohnt es sich, andere Beteiligungsbeispiele und deren Methoden genauer zu studieren (z.B. unter partizipation.at/partizipation-anwenden/methoden). Zudem kann es auch sehr hilfreich sein, Details in direkten Gesprächen mit den Prozessverantwortlichen zu klären.
In den einzelnen Beteiligungsphasen kommen meist mehrere Methoden zur Anwendung: z.B. am Beginn eine Online-Umfrage und Interviews, dann eine Informationsveranstaltung, dann ein kooperativer Planungsprozess. Auch in einer einzelnen Veranstaltung können verschiedene Methoden verwendet werden und einzelne Methoden können miteinander kombiniert werden.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung häufig verwendeter Methoden für die verschiedenen Beteiligungsstufen.
Weitere Methoden finden Sie z. B. unter:
- partizipation.at/methoden (Sie können verschiedene Methoden nach Gruppengröße, Dauer, Form der Beteiligung und Ähnlichem filtern.)
- wien.gv.at/stadtentwicklung/partizipation [unter Praxishandbuch Partizipation]
6.1 Methoden für die Beteiligungsstufe Information
Information ist eine Einwegkommunikation, bei der die Informierten keine Möglichkeit haben, Rückmeldung zu geben oder Fragen zu stellen. Eine gut durchdachte Informationstätigkeit vor Beginn eines Beteiligungsverfahrens kann jedoch entscheidend für dessen Erfolg sein und berücksichtigt auch all jene, die nur über den Fortschritt informiert werden wollen.
Postwurfsendung
Postwurfsendungen an einzelne Haushalte dienen zur Information der Öffentlichkeit. Sie enthalten eine Beschreibung des Vorhabens und den aktuellen Stand der Dinge, den zeitlichen Ablauf des Vorhabens, erwartete Ergebnisse, die Bekanntgabe von Terminen, Hinweise auf weitere Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten und eventuell auch schon eine Einladung zu einer Informations- oder Auftaktveranstaltung.
Worauf ist besonders zu achten?
- Die Inhalte von Postwurfsendungen müssen kurz, prägnant und gut verständlich formuliert werden.
- Sie unterscheiden sich deutlich von üblichen Werbeaussendungen, etwa durch die Verwendung eines Briefpapiers mit dem offiziellen Logo der Gemeinde oder durch ein besonderes Format.
- Bei Bedarf kann man in der Postwurfsendung auch eine Antwortmöglichkeit vorsehen, etwa mittels einer abtrennbaren Rückantwortkarte.
- Postwurfsendungen müssen eine:n klar erkennbare:n Absender:in sowie Rückfragehinweise (Kontaktperson, Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw.) enthalten.
- Bei Postwurfsendungen ist mit einem relativ hohen Verteilungsaufwand sowie mit Streuverlusten zu rechnen. Viele Wurfsendungen wandern ungelesen in den Papierkorb.
Aushang
Aushänge oder Plakate informieren wie Postwurfsendungen über Sachinhalte sowie über Termine und weitere Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten.
Worauf ist besonders zu achten?
- Damit Aushänge die gewünschte Wirkung (Information, Erinnerung) erzielen, müssen sie gut positioniert werden.
- Hilfreiche Fragen zum Gestalten eines Aushangs: Um welches Thema geht es? Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Wo treffen sich diese Personen? Wo ist Zeit zum Plaudern? (z. B. vor dem Gemeindeamt, vor der Kirche, Geschäften, in Gasthäusern, auf Märkten usw.).
- Der Inhalt von Aushängen muss in kurzer Zeit erfasst werden können: Sie sollten auffällig gestaltet sein, der Text muss gut gegliedert und noch kürzer als bei Postwurfsendungen sein, die Schrift groß und leicht lesbar.
- Die Gestaltung von Plakaten ist anspruchsvoll. Planen Sie Ressourcen für eine entsprechende fachliche Unterstützung (Grafik, Layout) ein.
Flyer, Postkarten
Flyer und Postkarten informieren wie Postwurfsendungen und Aushänge über Sachinhalte, Termine sowie weitere Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten.
Worauf ist besonders zu achten?
- Flyer und Postkarten können aufgelegt oder auch wie eine Postwurfsendung verschickt werden. Sie können auch aktiv verteilt werden, z. B. vor Geschäften, auf Märkten, in Fußgängerzonen.
- Flyer und Postkarten müssen an Orten aufgelegt werden, an denen sie von den Zielgruppen gesehen werden: in Lokalen, Geschäften, Bürgerservice-Stellen usw.
- Flyer müssen auffällig gestaltet sein, der Text muss sich auf das Wesentliche beschränken und gut lesbar sein.
- Planen Sie entsprechende Ressourcen für Grafik und Layout ein.
Ausstellung
Bei Ausstellungen werden Objekte gezeigt und detaillierte Informationen auf Plakatwänden angeboten. Ausstellungen können begleitend zu einer einzelnen Veranstaltung konzipiert werden, sie können aber auch modulweise im Verlauf eines Verfahrens immer wieder ergänzt und etwa in Form einer Wanderausstellung eingesetzt werden.
Worauf ist besonders zu achten?
- Ausstellungen sollen sowohl anregend wirken als auch detaillierte Information bieten. Die wesentlichen Inhalte einer Ausstellung (Texte, Bilder, Grafiken) müssen rasch erfassbar und selbsterklärend sein. Damit viele Menschen auf die Ausstellung aufmerksam werden, müssen die Inhalte auch aus einer Entfernung von zwei bis drei Metern gut lesbar sein.
- Der Aufwand für Konzeption, Realisierung, Aufbau und Betreuung von Ausstellungen sollte nicht unterschätzt werden.
- Wichtig sind auch die Wahl des geeigneten Ausstellungsortes und passende Öffnungszeiten.
- Die weitere Verwendung der Ausstellungstexte und -bilder an einem anderen Ort (transportable Tafeln) oder in einer anderen Form, z. B. als Infobroschüre, hat sich bewährt und sollte von Anfang an mitgedacht werden.
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit informiert die Bevölkerung über Inhalte, Ablauf und Ergebnisse von Vorhaben und spielt bei Beteiligungsprozessen eine wichtige Rolle für die Meinungsbildung.
Worauf ist besonders zu achten?
- Öffentlichkeitsarbeit bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung.
- Am Beginn eines Beteiligungsprozesses sollte deshalb ein Kommunikationskonzept (siehe Schritt 5.7) erstellt werden. Es enthält folgende Elemente: Kommunikationsziele, Zielgruppen, Kernbotschaften, Kommunikationskanäle (Print, online, Radio, Fernsehen) und Kommunikationszeitpunkte.
- Bauen Sie zu Beginn eines Beteiligungsprozesses Kontakt zu den relevanten Medien auf und bereiten Sie geeignete Pressetexte und Bilder vor. Mit einer verständlichen Aufbereitung von Prozessinhalten und -abläufen können Sie das Risiko einer missverständlichen Berichterstattung verringern.
- Die Öffentlichkeitsarbeit sollte über die gesamte Dauer eines Beteiligungsprozesses erfolgen und bekannt machen, was bereits erreicht wurde und wie die nächsten Schritte aussehen. Die zeitlichen Abstände zwischen den Veröffentlichungen sollten so gewählt werden, dass die Zielgruppen die Prozessfortschritte gut mitvollziehen können
6.2 Methoden für die Beteiligungsstufe Konsultation
Durch Konsultation kann ein Dialog entstehen, Informationen werden ausgetauscht, Bürger:innen können zu geplanten Vorhaben Stellung nehmen, in Foren diskutieren usw. Was mit den Rückmeldungen geschieht, bleibt jedoch in vielen Fällen offen und unverbindlich. Damit sind die Einflussmöglichkeiten von Bürger:innen auf ein geplantes Vorhaben begrenzt.
Einzelgespräche
Einzelgespräche sind für den Verlauf eines Beteiligungsprozesses sehr wichtig. Vor Prozessbeginn dienen sie der Kontaktaufnahme mit gut informierten Personen, Betroffenen und Beteiligten. Einzelgespräche ermöglichen den Austausch wichtiger Hintergrundinformationen und fördern den Aufbau von Beziehungen und Vertrauen. Im Rahmen dieser Gespräche können die Prozessbegleiter:innen herausfinden, was den einzelnen Beteiligten besonders wichtig ist. Einzelgespräche können auch im Lauf eines längeren Beteiligungsprozesses immer wieder eingesetzt werden.
Worauf ist besonders zu achten?
- Die Einzelgespräche sollten von den Personen geführt werden, die später den Beteiligungsprozess begleiten.
- Das Ziel des Gespräches ist klare Kommunikation. Die Gesprächspartner:innen sollen über die wichtigsten Punkte des Beteiligungsprozesses wie Inhalte, Beteiligungsgegenstand, Dauer und andere Beteiligte informiert werden. Dabei ist auf größtmögliche Transparenz zu achten.
- Die Fragestellung beeinflusst das Gesprächsergebnis mitunter stark. Es können sowohl offene (Wer? Wie? Was? Wo? Wann? Warum?) als auch geschlossene (mit ja oder nein zu beantwortende) Fragen verwendet werden. Suggestivfragen („Denken Sie nicht auch, dass ..?“) sind zu vermeiden.
- Als Unterstützung bei der Gesprächsführung ist die Verwendung eines Gesprächsleitfadens hilfreich. In einem Gesprächsleitfaden ordnen Sie die Fragen, die sie stellen möchten und überlegen sich eventuelle Rückfragen.
- Besonders wertvoll ist auch der Informationsaustausch im Rahmen informeller Gespräche. Planen Sie dafür Gelegenheiten wie Pausen, gemeinsame Mahlzeiten oder einen gemütlichen Ausklang nach einer Veranstaltung bewusst ein.
Online-Umfrage
Online-Umfragen bieten die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit die Meinungen und Einschätzungen einer großen Anzahl von Personen in Erfahrung zu bringen. Umfragen können als Vorbereitung eines Beteiligungsprozesses anstelle von Einzelgesprächen oder auch zur Ergänzung eingesetzt werden. Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Befragung erfolgt am besten durch die Prozessbegleiter:innen.
Worauf ist besonders zu achten?
- Ziele: Was wollen Sie mithilfe der Umfrage erreichen?
- Inhalte: Was genau wollen Sie von den Befragten wissen?
- Teilnehmer:innen: Wen wollen Sie befragen und wie können Sie diese Personen erreichen?
- Umfang: Beschränken Sie sich auf die relevantesten Fragen und testen Sie die Dauer für die Beantwortung ab. Informieren Sie die Befragten im Anschreiben über den Zeitaufwand für die Beantwortung der Fragen.
- Fragen: Arbeiten Sie mit einer Kombination aus geschlossenen Fragen, Multiple-Choice-Fragen und offenen Fragen.
- Wie wollen Sie die Ergebnisse in einem allfälligen Beteiligungsprozess nutzen? Machen Sie im Fragebogen oder im Anschreiben deutlich, was mit den Ergebnissen geschehen wird bzw. wo die Ergebnisse einzusehen sind.
- Stimmen Sie die Fragen mit Ihren (politischen) Auftraggeber:innen bzw. mit der Steuerungsgruppe des Beteiligungsprozesses ab.
Informations- und Auftaktveranstaltung
Informations- und Diskussionsveranstaltungen bieten die Möglichkeit, über Themen oder Vorhaben zu informieren und dabei unterschiedliche Meinungen sichtbar zu machen. Diskussionsveranstaltungen müssen sorgfältig geplant und vorbereitet werden, insbesondere im Hinblick auf Ziele, Zielgruppen, Termin, Ort, Ablauf, Mitwirkende und Moderation.
Worauf ist besonders zu achten?
- Ziele und Inhalte der Diskussionsveranstaltung müssen bereits in der Einladung klar beschrieben werden. Zeitpunkt, Dauer und Veranstaltungsort sind so zu wählen, dass die Zielgruppen ohne Hemmnisse teilnehmen können.
- Die Einladung so zu erstellen, dass sich die Teilnehmer:innen auch tatsächlich eingeladen fühlen: klar, verständlich, freundlich, offen und wertschätzend. Die Basisinformationen wie Ort, Beginn und Ende, Thema (Worum geht es) müssen auf den ersten Blick erfassbar sein.
- Die Inhalte müssen prägnant und für alle gut verständlich präsentiert werden.
- Die Diskussionsbeiträge der Anwesenden können bereits während der Veranstaltung für alle sichtbar gemacht werden, zum Beispiel über Flipcharts oder Videobeamer.
- Während der Veranstaltung können Fragen der Teilnehmer:innen über interaktive Online-Tools wie Mentimeter gesammelt werden.
- Mithilfe dieser Instrumente können auch Meinungsbilder von den anwesenden Personen eingeholt werden.
- Am Ende einer Diskussionsveranstaltung muss kommuniziert werden, was mit den Ergebnissen passieren wird.
- Die Inhalte und Ergebnisse der Veranstaltung können den Teilnehmer:innen als Download zur Verfügung gestellt werden.
- Die Organisator:innen einer Diskussionsveranstaltung sollten sich immer mehrere Szenarien überlegen und sich auf heikle Situationen vorbereiten. Was passiert, wenn sehr viele oder nur sehr wenige Personen teilnehmen? Ist eine Anmeldungspflicht zweckmäßig? Welches Setting ist am besten geeignet: z. B. Podiumsdiskussion, Fishbowl? Welche Fragen oder heikle Themen sind zu erwarten? Wer kann diese Fragen beantworten? Wie reagiert die Moderation, wenn Konflikte aufbrechen?
Workshop
Bei einem Workshop arbeiten unterschiedliche Personen (Mitarbeiter:innen aus der Verwaltung, Bürger:innen, Planer:innen usw.) gemeinsam an bestimmten Themen und Fragen, etwa an einer Vulnerabilitätsanalyse für eine Gemeinde, an der Erstellung eines Anpassungskonzepts, an einem konkreten Entsiegelungsvorhaben usw. Ziel ist es, Antworten und Lösungen zu finden und das weitere Vorgehen zu klären.
Im Vergleich zu einer Informationsveranstaltung nehmen an einem Workshop in der Regel deutlich weniger Personen teil. Der interaktive Austausch zwischen den Teilnehmenden steht im Vordergrund.
Worauf ist besonders zu achten?
- Der Ablauf des Workshops ist detailliert zu planen, am besten mit Unterstützung einer Moderation: Welche Ziele sollen erreicht werden? Welche Ergebnisse sollen am Ende vorliegen? Wie ist der Workshop zu gestalten?
- Teilnehmer:innen: Welche und wie viele Personen werden anwesend sein? Welche Inhalte, Standpunkte und Interessen werden diese Personen einbringen? Was bedeutet dies für den Programmablauf?
- Welche Informationen benötigen die Teilnehmer:innen, damit sie die Themen und Fragen gut bearbeiten können? Sollen Unterlagen vorab ausgeschickt werden oder genügt es, die relevanten Informationen am Beginn der Veranstaltung zu vermitteln?
- Workshops ermöglichen ein intensives und konstruktives Arbeiten. Deshalb ist besonders auf die organisatorischen Rahmenbedingungen zu achten: kurze, wenn möglich öffentliche Anreise, ein Veranstaltungsort mit angenehmer Atmosphäre und ausreichend Platz, technische Ausstattung, Moderationsmaterial, Verpflegung usw.
- Methodenauswahl: Je nach Workshop-Ziel können unterschiedliche Methoden eingesetzt und auch miteinander kombiniert werden (z. B. World-Café, Placemat, Ideenschmiede, siehe partizipation.at/methoden).
- Dokumentation der Ergebnisse: Ein Flipchart-Protokoll kann zumeist recht einfach erstellt werden. Zusätzlich braucht es manchmal eine schriftliche Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse und allfälligen Vereinbarungen.
Arbeitsgruppe, Ausschuss
In Arbeitsgruppen und Ausschüssen beschäftigen sich ausgewählte Personen intensiv mit einzelnen Themen und Fragen, sie diskutieren z. B. über Planungsvorschläge, erarbeiten Lösungsalternativen, formulieren Texte und stellen ihre Ergebnisse anderen zur Verfügung. Damit ein intensives Arbeiten möglich ist, sollte die Anzahl der Teilnehmer:innen begrenzt werden. Die Mitglieder werden aufgrund ihrer fachlichen Qualifikationen ausgewählt, es kann sich dabei um Fachleute aus Büros, Forscher:innen, Funktionär:innen von Interessenverbänden und auch um Vertreter:innen betroffener Gruppen handeln.
Worauf ist besonders zu achten?
- Die Mitglieder der Arbeitsgruppe und deren Aufgaben sollten klar definiert sein.
- Zeitpunkt und Dauer der Arbeitsgruppe sind ebenfalls festzulegen.
- Die Kommunikation zwischen der Arbeitsgruppe und den anderen Beteiligten im Gesamtprozess muss sichergestellt werden.
- Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe müssen in den Gesamtprozess eingespielt werden.
Begehung, Lokalaugenschein, Exkursion
Die Teilnehmer:innen einer Begehung haben die Möglichkeit, sich direkt an Ort und Stelle ein Bild über das geplante Vorhaben, ein bestimmtes Thema oder einen Konflikt zu machen. Die Meinungen der unterschiedlichen Akteur:innen zu bestimmten Fragen können unmittelbar dort besprochen werden, wo die Themen, Fragen und Probleme zutage treten.
Worauf ist besonders zu achten?
- Bei komplexen Themen oder großen Gebieten sind mehrere Begehungen (zu verschiedenen Zeitpunkten oder Inhalten) zweckmäßig.
- Die Anzahl der Teilnehmer:innen soll nicht zu groß sein (10 bis 15) Personen. Wenn mehr Personen teilnehmen, ist eine Teilung in Untergruppen sinnvoll.
- Überlegen Sie sich die Begehungsroute und die relevanten Informationspunkte im Vorfeld: Was ist das Ziel der Begehung? Was soll in welcher Reihenfolge gezeigt werden? Wie viel Zeit steht zur Verfügung? Wie lange sind die Anfahrtswege? Wie und wo können Informationen (Pläne usw.) gezeigt werden?
- Begehungen sind wertvolle gemeinsame Aktivitäten. Sie bieten eine große Chance, die Zusammenarbeit der Beteiligten zu fördern und das gegenseitige Vertrauen zu stärken. Neben der Diskussion fachlicher Fragen können die Teilnehmer:innen auch auf persönlicher Ebene Kontakte knüpfen und einander besser kennenlernen. Ein gemeinsamer gemütlicher Ausklang mit Gelegenheit zu Gesprächen bei Getränken und eventuell einem Imbiss kann sich sehr positiv auswirken und verhärtete Positionen aufweichen.
- Lokalaugenscheine bieten insbesondere Grundeigentümer:innen, Bewirtschafter:innen von Flächen und Anrainer:innen die Gelegenheit, ihr lokales Wissen und ihre Expertise einzubringen.
- Die Ergebnisse von Begehungen sollten gut dokumentiert (Protokoll, Fotos) und bei der nächsten Sitzung besprochen werden.
Open Space
Eine Open-Space-Veranstaltung dient dazu, möglichst viele Personen zu mobilisieren, deren Ideen und Vorschläge einzubringen und gemeinsam komplexe Themen zu erörtern, ohne bereits konkrete Lösungen zu formulieren oder Entscheidungen zu treffen. Wie der Name schon sagt: der Open Space bietet einen offenen Raum.
Open Space als Methode entstand aus der Erkenntnis, dass bei vielen Veranstaltungen die entscheidenden Gespräche in der Pause, also in einem informellen Rahmen stattfinden. Beim Open Space wird die Pause zum Hauptprogramm: Es gibt nur ein generelles Leitthema (z.B. die Zukunft der Gemeinde X), die Teilnehmer:innen entscheiden, welche Themen sie im Detail bearbeiten wollen, und sie bringen diese Themen selbst ein. Für die Bearbeitung der Themen stehen Räume zur Verfügung. Diejenigen, die ein Thema einbringen, verpflichten sich lediglich, am Ende ein Protokoll der Diskussion in ihrer Gruppe zu erstellen. Die gesammelten Protokolle werden den Teilnehmer:innen am Ende der Veranstaltung übergeben.
Damit unterscheidet sich der Open Space deutlich von Veranstaltungen, bei denen die veranstaltenden Organisationen die Ziele, Themen, Fragen und die Austauschformate festlegen. Beim Open Space liegt die Verantwortung für die Themen, deren Bearbeitung und die Dokumentation der Ergebnisse bei den Teilnehmer:innen selbst.
Worauf ist besonders zu achten?
- Die Veranstalter:innen kümmern sich in erster Linie um geeignete Räumlichkeiten und eine konstruktive Atmosphäre. Weiters müssen sie zu Beginn die Besonderheiten dieses Formats vermitteln und die Teilnehmer:innen auf ihre Eigenverantwortung hinweisen.
- Besonders wichtig ist, dass am Ende der Veranstaltung geklärt wird, was mit den Ergebnissen passiert und wie die Teilnehmer:innen über den weiteren Verlauf informiert werden.
- Bei einem Open Space liegt die Verantwortung für das Gelingen in erster Linie bei den Teilnehmer:innen. Wenn sich niemand einbringt, passiert nichts. Allerdings haben die Teilnehmer:innen bei einem Open Space Gestaltungsmöglichkeiten wie bei kaum einer anderen Veranstaltungsform.
Bürger:innenrat
Ein Bürger:innenrat ist eine Konsultationsmethode, bei der die Bürger:innen eine zentrale Rolle spielen. Die Bürger:innen einer Gemeinde, eines Bundeslandes oder des gesamten Bundesgebietes werden zufällig ausgewählt, und zwar so, dass sie das jeweilige Gesamtsystem möglichst gut repräsentieren (Alter, Geschlecht, soziale Gruppen usw.). Sie diskutieren ergebnisoffen und erarbeiten in mehreren Schritten Lösungsvorschläge zu gesellschaftlichen Fragen (z. B. gab es zum Klimathema den österreichischen Klimarat mit 100 ausgewählten Bürger:innen), die dann den politischen Entscheidungsträger:innen vorgelegt werden. Der Bürger:innenrat trifft selbst keine Entscheidungen und ist oftmals in ein größeres Beteiligungssetting eingebettet.
Worauf ist besonders zu achten?
- Die Dauer eines Bürger:innenrats reicht von ein bis zwei Tagen bis zu mehreren Monaten.
- Der Bürger:innenrat in einer Gemeinde besteht in der Regel aus ca. 12 bis 16 Mitgliedern. Es gibt aber auch wesentlich größere Bürger:innenräte, die dann entsprechende Begleitstrukturen benötigen.
- Die Begleitung eines Bürger:innenrats setzt viel Moderationserfahrung voraus, insbesondere auch mit der Methode „Dynamic Facilitation“, die hier oftmals zur Anwendung kommt (siehe partizipation.at/methoden/dynamic-facilitation).
- Der Bürger:innenrat eignet sich nicht für die Bearbeitung hocheskalierter Konflikte.
6.3 Methoden für die Beteiligungsstufe Mitentscheiden
Auf dieser Beteiligungsstufe reicht die Beteiligung am weitesten. Die Beteiligten wirken aktiv an der Planung eines Vorhabens mit und können dieses damit stark beeinflussen. Die methodischen und organisatorischen Anforderungen sind bei dieser Beteiligungsstufe besonders hoch und sollten gut vorbereitet sein.
Kooperativer Planungsprozess
Kooperative Planungsprozesse nutzen das Wissen der verschiedenen Beteiligten wie Bürger:innen, Mitarbeiter:innen der Verwaltung, Planer:innen, Forscher:innen und NGOs für Projekte, die umfangreiche Fachexpertise und mehrstufige Entscheidungsprozesse erfordern.
Kooperative Planungsprozesse beginnen oftmals mit Einzelgesprächen, Umfragen und Informationsveranstaltungen und führen zur Einrichtung eines Gremiums, das Ziele und Maßnahmenvorschläge erarbeitet. Aus den Prozessen gehen Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträger hervor, sie dauern in der Regel mehrere Monate bis über ein Jahr.
Worauf ist besonders zu achten?
- Die Einflussmöglichkeiten der Beteiligten müssen von Beginn an geklärt werden: Welche Handlungs- und Entscheidungsspielräume gibt es? Was passiert mit den Ergebnissen des Prozesses?
- Ein zweiter besonders wichtiger Punkt ist der Übergang von der Planung zur Umsetzung, der oftmals mit einem Wechsel der verantwortlichen Akteur:innen verbunden ist. Dieser Übergang muss präzise vorbereitet werden, damit die ausgehandelten Ergebnisse auch tatsächlich zur Umsetzung gelangen. Aus diesem Grund werden jene, die später mit der Umsetzung betraut sind, zu einem passenden Zeitpunkt in den Beteiligungsprozess eingebunden.
- Die Entscheidungsregeln werden vor Beginn des Prozesses vereinbart.
- Für kooperative Planungsverfahren sind aufgrund ihrer Dauer und Komplexität ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen (samt Reserven) einzuplanen. Bei großen Gruppen sind in der Regel zwei Moderator:innen erforderlich.
Mediationsverfahren
Mediation ist eine Methode der Konfliktaushandlung, bei der die Konfliktparteien gemeinsam mit Mediator:innen am Beginn Ziele und Spielregeln festlegen. Zu den Spielregeln zählen u.a. die Festlegung, wer am Prozess teilnimmt, wie die Prozessziele lauten, wie oft und wo sich die Beteiligten treffen, wie sie miteinander umgehen (zuhören!), wie sie gemeinsam Entscheidungen treffen und wie die Kommunikation nach außen erfolgen soll.
Die Mediator:innen unterstützen die Akteur:innen dabei, Themen, Positionen und Interessen offenzulegen, gemeinsam Lösungsideen zu entwickeln und einvernehmliche Vereinbarungen zu treffen, die dann schriftlich festgehalten werden.
Worauf ist besonders zu achten?
- Mediation beruht auf Freiwilligkeit. Diese Methode kann nur dann eingesetzt werden, wenn alle Konfliktparteien dazu bereit sind.
- Mediation setzt voraus, dass die Konfliktparteien in der Lage sind, eigenverantwortlich Vereinbarungen zu treffen. Bei der Auswahl der Beteiligten ist besonders darauf zu achten, dass alle Gruppen eingebunden sind, die vom Konflikt betroffen sind und für die Umsetzung von Vereinbarungen gebraucht werden.
- Die Mediator:innen müssen über gute kommunikative Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen – und von den Beteiligten akzeptiert werden.
- Die Entscheidungsregeln müssen zu Beginn des Prozesses vereinbart werden.
- Mediationsverfahren sind je nach Dauer und Komplexität mit ähnlich hohen Kosten verbunden wie kooperative Planungsprozesse. Sie erfordern ebenfalls eine sehr gute Organisation. Die Dauer der Prozesse kann von einigen Monaten bis zu ein bis zwei Jahren reichen. Bei großen Gruppen sind in der Regel zwei Mediator:innen erforderlich.
6.4 Online-Beteiligung
Die Erfahrungen während der Covid-19-Pandemie haben gezeigt, dass Beteiligungsformate in allen drei Stufen auch online gut funktionieren können. Sie sind zwar mit einigen Einschränkungen verbunden, haben aber den Vorteil, dass mehr Bevölkerungsgruppen erreicht werden können, selbst wenn diese räumlich weit entfernt sind. Für die Diskussion von Themen und das interaktive Erarbeiten von Lösungen stehen verschiedene Instrumente wie Padlet, Miro oder Mentimeter zur Verfügung und haben sich auch bewährt. Gemeinsames Arbeiten an Texten funktioniert zum Beispiel mittels Google docs oder OneDrive.
Online-Methoden können auch gut als Ergänzung zu analogen Formaten eingesetzt werden, weil damit ein weiterer Personenkreis einbezogen werden kann oder aktuelle Stimmungsbilder sichtbar gemacht werden können (z. B. Menti-Umfrage bei einer Informationsveranstaltung).
Weitere Anregungen zur Beteiligung im digitalen Raum finden Sie unter: vorarlberg.at/-/raumwechsel.
Worauf ist besonders zu achten?
- Online-Methoden stellen für ältere Menschen oft eine unüberwindbare technische Hürde dar. Menschen, die wenig technikaffin sind, fühlen sich mit digitalen Formaten oftmals unwohl und überfordert.
- Die nonverbale Kommunikation, ein wesentliches Element im zwischenmenschlichen Austausch, ist bei digitalen Formaten stark eingeschränkt.
- Die Moderation digitaler Formate erfordert neben der inhaltlichen Ebene auch den technischen Support, der die Moderationskosten deutlich erhöht.
- Besonders aufwendig sind Hybridformate, d. h. die Mischung von physischer Präsenz und digitaler Teilnahme innerhalb einer Veranstaltung. Die Kommunikation in eine Richtung, z. B. Streaming, stellt kein großes Problem dar. Kompliziert wird es jedoch, wenn sich in hybriden Settings mehrere physisch anwesende Personen und mehrere online Teilnehmende austauschen oder gemeinsam etwas erarbeiten sollen. Hier braucht es eine hochwertige technische Ausstattung und große Expertise im Umgang mit den Tools sowie eine intensive technische Betreuung, die mit hohen Kosten verbunden ist.
6.5 Beteiligungsbeispiel: Ein klimafitter Hauptplatz
Die Leiterin des Umweltamtes bittet die Prozessbegleiterin, den Vorschlag für die Gestaltung des Beteiligungsprozesses auch im Gemeinderat vorzustellen, damit allfällige Bedenken und Anliegen der Gemeinderatsmitglieder, insbesondere auch der Opposition, besprochen und ausgeräumt werden können.
Die Prozessbegleiterin präsentiert die Prozessorganisation und den Prozessablauf und fasst das Wesentliche am Ende noch einmal zusammen: Es handelt sich um einen kooperativen Aushandlungsprozess, d. h., die relevanten Akteur:innen und auch die Bürger:innen werden sehr weit in die Entscheidungsvorbereitung einbezogen.
Die finale politische Entscheidung über die Umgestaltung zu einem klimafitten Hauptplatz trifft jedoch klarerweise der Gemeinderat. Da dieser von Beginn an in den Prozess einbezogen ist, sollte sichergestellt sein, dass der Beschluss über die Umsetzung der Vorschläge aus dem Beteiligungsprozess ohne große Widerstände erfolgen kann.
Wichtig ist, dass der Bürgermeister bei der öffentlichen Informationsveranstaltung und auch bei der Startsitzung des Forums ein klares Bekenntnis dazu abgibt, dass die Gemeinde tragfähige gemeinsame Ergebnisse aus dem Aushandlungsprozess in der Folge auch umsetzen wird.
Während des Prozesses kommen unterschiedliche Methoden zur Anwendung: In einem ersten Schritt führt die Prozessbegleiterin Einzelgespräche. Die Einladung zur ersten Informationsveranstaltung erfolgt über eine Postwurfsendung und über einen Flyer, der an verschiedenen Orten aufliegt. In den Tagen vor der Veranstaltung stellt die Gemeinde im öffentlichen Raum Plakatständer mit einem Hinweis auf die Veranstaltung auf. Im Nachklang der öffentlichen Veranstaltungen können jene, die nicht an den Veranstaltungen teilnehmen konnten, ihre Anliegen auf einer digitalen Plattform der Gemeinde einbringen.
Bei der Arbeit des Forums kommen verschiedene Methoden zur Anwendung, z. B. Word-Café, Placemat und Lokalaugenschein. Je nachdem, wie sich der Prozess entwickelt, kann die Prozessbegleiterin auch auf weitere Methoden zurückgreifen.
Der Prozessfortschritt wird in der Steuerungsgruppe regelmäßig reflektiert. Wenn diese zur Einschätzung kommt, dass Kurskorrekturen nötig sind, kann sie diesbezügliche Entscheidungen treffen. So ist sichergestellt, dass der Prozess weder zeitlich, inhaltlich noch finanziell aus dem Ruder läuft.
Die Mitglieder des Gemeinderats stimmen dem Vorgehen zu, behalten sich jedoch vor, bei ihrem Beschluss über die Planungsvorschläge auch Abstriche zu machen, wenn dies aus finanziellen Gründen notwendig erscheint.