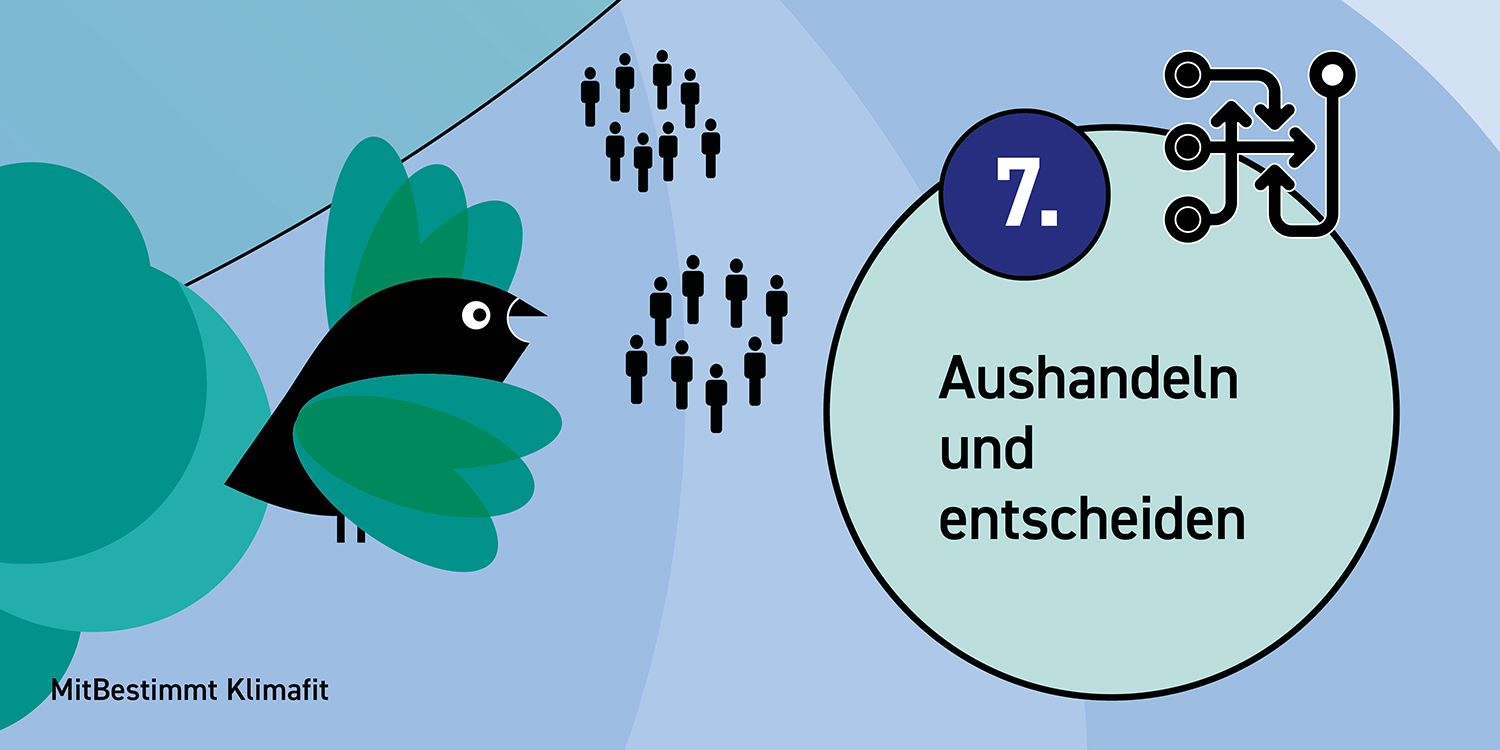7. Aushandeln und entscheiden
In der Vorbereitungsphase haben Sie eine Einschätzung der Lage für Ihr Vorhaben vorgenommen, die Handlungsmöglichkeiten beurteilt und die Beteiligungsziele sowie den Beteiligungsgegenstand und die Beteiligten definiert. Sie haben die Organisationsstruktur festgelegt, den Prozessablauf konzipiert und geeignete Methoden ausgewählt. Außerdem haben Sie auch die nötigen finanziellen Ressourcen für den Beteiligungsprozess sichergestellt. Sie haben somit geeignete Rahmenbedingungen für einen professionellen Beteiligungsprozess geschaffen – nun kann es losgehen!
7.1 Erfolgsfaktoren für einen gelungenen Beteiligungsprozess
Prozesssteuerung
- Der Prozess wird von professionellen und unabhängigen Moderator:innen bzw. Mediator:innen begleitet.
- Reflexion und Supervision über den Prozess und den Inhalt finden kontinuierlich statt, damit allfällige Kurskorrekturen vorgenommen werden können.
- Der Verfahrensablauf wird gut organisiert (Zeitplan, Tagungsräume, Protokollierung etc.).
- Die Prozessbegleiter:innen achten auf Methodenvielfalt.
- Die Prozessbegleiter:innen und die anderen Beteiligten sorgen für größtmögliche Kontinuität der Arbeit und versuchen, störende Unterbrechungen so gut wie möglich zu vermeiden.
Einladungen
- Es wird eine Vielzahl von Verbreitungskanälen genutzt, um eine möglichst diverse Teilnehmer:innengruppe zu erreichen. Zum Beispiel werden Einladungen analog über lokale Zeitungen, lokale Organisationen und Postsendungen sowie digital über soziale Medien und Newsletter verbreitet.
- Die Einladungen sind persönlich gestaltet, damit sich die Betroffenen angesprochen fühlen.
- Es werden Möglichkeiten zum Austausch nach einer Veranstaltung mit entsprechender Verpflegung bereitgestellt.
Umgang mit Informationen und Wissen
- Ergänzendes Expert:innenwissen wird verfügbar gemacht, damit Entscheidungen fundiert getroffen werden können.
- Alle für den Prozess relevanten Informationen werden den Beteiligten rechtzeitig zur Verfügung gestellt: Vorinformation schafft Vertrauen.
- Das Verfahren wird nachvollziehbar dokumentiert (Protokolle, Zwischenberichte etc.).
- Die Öffentlichkeit wird über das Vorhaben informiert.
- Es gibt ausreichend Flexibilität im Prozess in Bezug auf die Rahmenbedingungen und den Verhandlungsgegenstand. Falls erforderlich, sind Kurskorrekturen im erforderlichen Ausmaß möglich.
Spielregeln für den Umgang miteinander
Allgemein
- Während des Verfahrens herrscht Klarheit über die Rollen aller Beteiligten (z. B.: Wer spricht für wen mit welcher Handlungsbefugnis?).
- Alle Meinungen werden im Verfahren gehört und diskutiert.
- Die Teilnehmer:innen nehmen die Ängste der anderen ernst.
- Das Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten wird gestärkt, damit ein höherer Grad an Verbindlichkeit der Ergebnisse entsteht.
- Das Zeit-Nutzen-Verhältnis ist für alle Beteiligten akzeptabel.
- Der Einsatz finanziell nicht abgegoltener Ressourcen wird transparent gemacht.
- Die Aufteilung der Finanzmittel wird offengelegt.
Unter der Anleitung von Prozessbegleiter:innen
- Die Prozessbegleiter:innen sorgen für klare und faire Spielregeln sowie Vereinbarungen über Ablauf, Rollen, Rechte und Pflichten der Beteiligten sowie den Entscheidungsmodus innerhalb des Verfahrens (konsensuale Entscheidungen, Mehrheitsentscheidungen etc.).
- Die Prozessbegleiter:innen legen mit den Beteiligten Regeln für die Gruppenkultur fest: Wie sieht ein fairer Umgang miteinander aus? Wie gehen wir mit dem im Prozess erworbenen Wissen um? Wie können wir eine offene und wertschätzende Atmosphäre schaffen?
- Die Prozessbegleiter:innen sorgen für ein respektvolles und faires Gesprächsklima: Die Teilnehmer:innen hören einander zu, lernen, sich in die anderen Personen hineinzuversetzen, und nehmen einander ernst.
- Die Prozessbegleiter:innen sorgen dafür, dass unterschiedlichen Ansprüchen, Beiträgen und Sichtweisen im Verfahren Rechnung getragen wird.
- Alle Prozessbeteiligten, jedoch insbesondere die Prozessbegleiter:innen, sorgen für personelle Kontinuität und für die Integration neuer Teilnehmer:innen.
Kommunikation und Umsetzung der Ergebnisse
- Zur Umsetzung der Ergebnisse und deren Kontrolle werden tragfähige Vereinbarungen getroffen.
- Die Beteiligten vereinbaren gemeinsam, wie die Entscheidung und die Ergebnisse nach außen kommuniziert werden.
- Die Beteiligten verpflichten sich dazu, das Ergebnis als gemeinsame Leistung zu präsentieren.
7.2 Aushandeln und Entscheiden in mehreren Phasen
Der Prozessschritt des Aushandelns und Entscheidens kann je nach Beteiligungsstufe und Methode unterschiedlich aussehen. Es können folgende Phasen unterschieden werden:
- Startphase: Die Beteiligten lernen sich kennen, erhalten grundlegende Informationen über das Vorhaben und den Beteiligungsprozess (Ziele, Organisationsstruktur, Zeitplan) und vereinbaren Spielregeln im Umgang miteinander.
- Aushandlungsphase: Die Beteiligten tauschen ihre Positionen und Interessen aus, diskutieren die relevanten Themen und suchen nach gemeinsamen Lösungen. Je nach Komplexität des Themas und Ausmaß der Interessenunterschiede, kann die Aushandlungsphase kürzer oder länger dauern.
- Entscheidungsphase: Die Beteiligten treffen Vereinbarungen und Entscheidungen.
- Abschlussphase: Die Beteiligten beenden den Aushandlungsprozess gemeinsam.
- Nachbereitung: Die Ergebnisse werden dokumentiert und verbreitet.
Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der genannten Phasen anhand von zwei Beispielen genauer dargestellt. Das erste Beispiel ist eine Diskussionsveranstaltung, das zweite Beispiel beschreibt einen kooperativen Planungsprozess. Dazu noch ein wichtiger Hinweis: Sämtliche Vorbereitungsschritte für diese beiden Beispiele sind bereits in den Schritten 1 bis 6 durchzuführen.
7.2.1 Beispiel: Diskussionsveranstaltung zum Thema Beschattung von Plätzen
Vorbereitung
Im Zuge der Schritte 1 bis 6 wurden bereits folgende Punkte geklärt:
- Ziele für die Veranstaltung, Zielgruppen und Teilnehmer:innen
- Zeitpunkt und Ort (Teilnahme soll leicht möglich sein z. B. analog und digital), zeitliche Dauer (z. B. 2,5 bis 3 h) und Programmablauf im Detail
- Vortragende und andere Expert:innen, Moderation, Beteiligungsmethoden (z. B. Podium, Fishbowl, World-Café, Placemat usw.)
- Kosten der Veranstaltung
- Inhalt, Form und Zeitpunkt der Einladung (2 bis 3 Wochen vor der Veranstaltung) und weitere Öffentlichkeitsarbeit
- Technische Anforderungen (Licht, Ton, Moderationsmaterial wie Pinnwände, Flipcharts usw.)
- weiterer Umgang mit den Ergebnissen
Startphase
- Am Beginn der Veranstaltung stehen die Begrüßung durch die Verantwortlichen, ein Überblick über den Ablauf des Abends sowie eine Vorstellungsrunde oder eine andere Form, die Anwesenden sichtbar zu machen, z. B. Abfragen mittels Handzeichen: Welche Institutionen sind heute vertreten, welche Stadtteile, welche Altersgruppen usw.
- Danach folgt ein inhaltlicher Einstieg, z. B. in Form von kurzen Vorträgen, Videos oder eines Gruppeninterviews zum Thema des Abends.
Aushandlungsphase
- Nach den inhaltlichen Inputs kann z. B. eine Ausstellung mit Plakaten zu den wichtigsten Aspekten des Themas folgen. Die Teilnehmer:innen können dabei ihr Wissen vertiefen, erhalten Auskünfte von Expert:innen und können z. B. mittels Post-its Feedback geben und eigene Vorschläge einbringen.
- Eine weitere Aushandlungsmöglichkeit besteht darin, zu den zentralen Themen und Fragen des Abends Kleingruppen zu bilden. Die Teilnehmer:innen diskutieren an mehreren, z. B. thematisch unterschiedlichen Tischen, geben Rückmeldungen zu Planungsvorschlägen und erarbeiten auch eigene Lösungsvorschläge.
- In dieser Phase kann es bei kontroversen Themen und großen Gegensätzen zwischen den Ansichten der Teilnehmer:innen durchaus zu Emotionen und eskalierenden Situationen kommen. Für derartige Situationen sind in der Vorbereitungsphase Vorkehrungen zu treffen, z. B. im Hinblick auf den Veranstaltungsort, den Zeitpunkt, den Ablauf, die Vortragenden und Diskussionsteilnehmer:innen eines Podiums, das Raumsetting usw. Sollte es dennoch zu einer Eskalation kommen, liegt es an den Moderator:innen oder Mediator:innen, die Situation mithilfe ihres Methodenrepertoires wieder zu beruhigen.
Entscheidungsphase
- Die Kleingruppen stellen die Ergebnisse ihrer Diskussion kurz im Plenum vor.
- In einer Einzelveranstaltung, z. B. zum Thema Beschattung von Plätzen, werden in der Regel keine Entscheidungen getroffen. Es ist jedoch gut möglich, am Ende der Veranstaltung ein Stimmungsbild für verschiedene Lösungsvorschläge einzuholen (etwa über ein digitales Tool wie Mentimeter oder über die Vergabe von Punkten auf Plakaten).
Abschlussphase
- Am Ende der Veranstaltung erläutern die Verantwortlichen, was mit den Ergebnissen der Veranstaltung geschieht und wo die Dokumentation zu finden ist. Die Verantwortlichen bedanken sich bei den Teilnehmer:innen für ihr Interesse und ihre Mitwirkung.
- Im Anschluss empfiehlt sich ein gemütlicher Ausklang
Nachbereitung
- Die Verantwortlichen der Veranstaltung oder z. B. die Moderator:innen bereiten die Ergebnisse auf, etwa in Form eines Flipchart-Protokolls und allenfalls einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und Stimmungsbilder. Die Teilnehmer:innen werden darüber informiert, wo das Protokoll einzusehen ist.
- Die Verantwortlichen informieren die breite Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Veranstaltung.
- Nach der Veranstaltung ist es ratsam, dass die Verantwortlichen und die Moderator:innen die Veranstaltung (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung) kurz reflektieren: Was hat gut funktioniert? Was könnte beim nächsten Mal verbessert werden? Wie sieht die weitere Vorgangsweise aus?
7.2.2 Beispiel: Gemeinsam eine Klimawandelanpassungsstrategie entwickeln
Vorbereitung
Im Zuge der Schritte 1 bis 6 wurden bereits folgende Punkte geklärt: Ziele für den Erarbeitungsprozess, Beteiligungsgegenstand und Beteiligte, Prozessorganisation, zeitliche Dauer und Fahrplan, externe Prozessbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit und Kosten. Diese Punkte wurden in einem Konzept zusammengefasst und vom Gemeinderat abgesegnet. Die Prozessbegleiter:innen haben bereits Gespräche mit den relevanten Akteur:innen geführt, zudem fand in der knapp sechsmonatigen Vorbereitungsphase eine digitale Umfrage unter der Bevölkerung statt.
Der Prozess beginnt mit einem Startmeeting, zu dem alle Beteiligten eingeladen werden (siehe auch ads Beispiel unter 7.2.1 Vorbereitung).
Kooperative Aushandlungsprozesse bestehen zumeist aus mehreren Sitzungen und Aushandlungsrunden, die jeweils gesondert zu konzipieren sind:
- Startphase: Kooperationsvereinbarungen treffen, Informationsgleichstand herstellen
- Aushandlungsphase, Runde 1: Themen sammeln, Vorgeschichte bearbeiten, Positionen und Interessen klären
- Aushandlungsphase, Runde 2: Ziele erarbeiten, Maßnahmen konzipieren, Prioritäten setzen
- Aushandlungsphase, Runde 3: Maßnahmen präzisieren, Handlungsprogramme zur Umsetzung der Maßnahmen festlegen
- Entscheidungsphase: Entscheidungen treffen, Lösungen vereinbaren, Meinungsverschiedenheiten festhalten
- Abschlussphase: Ergebnisse zusammenfassen, Maßnahmen zur Überprüfung der Umsetzung festlegen
Startphase
- In der Startphase eines Beteiligungsprozesses geht es darum, eine gemeinsame Ausgangsbasis zu schaffen. Die erste gemeinsame Sitzung der Beteiligten ist von besonderer Bedeutung – was hier vermittelt wird, kann den gesamten Prozess prägen: die Atmosphäre im Raum, der Stil der Prozessbegleiter:innen, die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird usw. Die Startphase, insbesondere das Startmeeting, bedarf daher einer besonders sorgfältigen Vorbereitung. Die Startphase umfasst etwa zwei Sitzungen.
- Die Auftraggeber:innen bzw. die politisch Verantwortlichen erläutern den Hintergrund und die Aufgabenstellung, äußern sich zu ihren Verbindlichkeiten und übergeben an die Prozessbegleiter:innen.
- Die Prozessbegleiter:innen geben eine Übersicht über den Ablauf des Startmeetings, danach folgt eine Vorstellungsrunde: Wer sitzt am Tisch? In welcher Funktion?
- Die Prozessbegleiter:innen erläutern die Vorgeschichte (Schritte 1 bis 6), stellen die Prozessorganisation und den geplanten Prozessablauf (Sitzungsort, Dauer, zeitliche Abfolge der Sitzungen, Termine etc.) vor. Danach folgen Fragen und eine allfällige Diskussion.
- Im Anschluss daran präsentieren die Prozessbegleiter:innen Vorschläge für die Spielregeln im Umgang miteinander und stellen diese Vorschläge zur Diskussion. Zu diesen Spielregeln zählen u. a. die Art und Weise, wie gemeinsame Entscheidungen getroffen werden und wie der Umgang mit der Öffentlichkeit aussehen soll. Am Ende der Diskussion einigen sich die Beteiligten auf Spielregeln, die für den gesamten weiteren Prozess gelten sollen.
- Nach der Klärung der Spielregeln gehen die Prozessbegleiter:innen zu den inhaltlichen Punkten des Vorhabens über: Welche fachlichen Unterlagen liegen vor? Wer benötigt welche Unterlagen? Wie können diese bereitgestellt werden?
Aushandlungsphase: Erste Runde (ein bis zwei Sitzungen)
- Die Prozessbegleiter:innen sorgen für klare und faire Spielregeln sowie Vereinbarungen über Ablauf, Rollen, Rechte und Pflichten der Beteiligten sowie den Entscheidungsmodus innerhalb des Verfahrens (konsensuale Entscheidungen, Mehrheitsentscheidungen etc.).
- Die Prozessbegleiter:innen legen mit den Beteiligten Regeln für die Gruppenkultur fest: Wie sieht ein fairer Umgang miteinander aus? Wie gehen wir mit dem im Prozess erworbenen Wissen um? Wie können wir eine offene und wertschätzende Atmosphäre schaffen?
- Die Prozessbegleiter:innen sorgen für ein respektvolles und faires Gesprächsklima: Die Teilnehmer:innen hören einander zu, lernen, sich in die anderen Personen hineinzuversetzen, und nehmen einander ernst.
- Die Prozessbegleiter:innen sorgen dafür, dass unterschiedlichen Ansprüchen, Beiträgen und Sichtweisen im Verfahren Rechnung getragen wird.
- Alle Prozessbeteiligten, jedoch insbesondere die Prozessbegleiter:innen, sorgen für personelle Kontinuität und für die Integration neuer Teilnehmer:innen.
Aushandlungsphase: Zweite Runde (ein bis zwei Sitzungen)
Wenn die Interessen der Teilnehmer:innen allen bekannt sind, können die Verfahrensziele gemeinsam weiter präzisiert werden. Dazu können Sie folgende Fragen verwenden:
- Ziele sammeln: Was genau wollen wir mit dem Beteiligungsprozess erreichen?
- Ziele nach Themen ordnen: Was gehört zusammen, was nicht? Falls noch Ziele fehlen, können sie ergänzt werden?
- Ziele reihen: Welche Ziele sind uns besonders wichtig? Welche Ziele sind uns weniger wichtig?
- Ziele überprüfen: Wie realistisch ist es, dass wir diese Ziele gemeinsam erreichen können? Wer oder was könnte uns dabei behilflich sein? Wer oder was könnte das Erreichen dieser Ziele gefährden?
- Nach der Einigung auf einen Zielkatalog stellt sich die Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Zielerreichung. Zunächst sammeln die Beteiligten Vorschläge und präzisieren diese. Das kann zu einer langen Liste möglicher Maßnahmen führen. In dieser Phase ist es oft sinnvoll, thematische Arbeitsgruppen zu bilden, um die relevanten Maßnahmen weiter auszuarbeiten.
Aushandlungsphase: Dritte Runde (zwei bis drei Sitzungen)
- Die eingesetzten Arbeitsgruppen präzisieren die Maßnahmenvorschläge, indem sie Aktivitäten, Zuständigkeiten, Kosten und Termine beschreiben. Diese Ergebnisse werden im Plenum auf Verträglichkeit und mögliche Konflikte geprüft. Nach der Diskussion im Plenum können die Arbeitsgruppen ihre Vorschläge überarbeiten und finalisieren.
- Diese Verhandlungsphase kann ein mehrmaliges Hin und Her zwischen Plenum und Arbeitsgruppen erforderlich machen, bis tragfähige, gemeinsame Lösungen gefunden sind.
- Ein wichtiger Zwischenschritt bei vorliegenden Lösungsvorschlägen ist die Rücksprache der Teilnehmer:innen mit ihren Herkunftsgruppen. Die Rückmeldungen dieser Gruppen führen oft zu einer Überarbeitung der Vorschläge und einer nochmaligen Klärungsrunde im Plenum. Abschließend werden die überarbeiteten Ergebnisse den Herkunftsgruppen erneut vorgelegt, um spätere Ablehnungen zu vermeiden.
Entscheidungsphase (ein bis zwei Sitzungen)
- In dieser Phase treffen die Beteiligten gemeinsam Entscheidungen und einigen sich auf Lösungen und Maßnahmen als Ergebnisse des Prozesses. Zusätzlich benennen sie auch jene Punkte, in denen sie sich nicht einig geworden sind. Diese Punkte können zukünftig in einem anderen Rahmen noch einmal aufgegriffen und bearbeitet werden.
- In der Entscheidungsphase kann es noch einmal zu größeren Konflikten kommen. Themen und Fragen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht zufriedenstellend ausgehandelt wurden, rücken in den Vordergrund. Manchmal kommen gänzlich neue Aspekte auf – z. B. im Hinblick auf die konkrete Umsetzung des Vorhabens – und müssen bearbeitet werden.
- Wichtig ist, dass sich die Beteiligten bereits in der Startphase des Prozesses darauf geeinigt haben, wie sie zu Entscheidungen kommen: z. B. Konsensprinzip, Abstimmung oder soziokratisches Entscheiden (siehe Box unten). Wichtig ist, dass es Regeln gibt und dass diese auch angewendet werden.
Abschlussphase
- Am Ende des Prozesses geht es darum, die Ergebnisse gut nachvollziehbar aufzubereiten. Dies kann etwa in Form eines Berichtes erfolgen, in dem die wesentlichen inhaltlichen Ergebnisse zusammengefasst werden, d. h. die gemeinsamen Lösungen und auch jene Punkte, bei denen man sich nicht einigen konnte. Weiters sollte der Bericht auch eine kurze Beschreibung des Arbeitsprozesses enthalten.
- Als Ergänzung zum Bericht braucht es kurze anschauliche Formate für die breite Öffentlichkeit (Medieninfo, Bilder usw.).
- Weiters sollte der Ergebnisbericht auch Aussagen darüber enthalten, wie die weiteren politischen Entscheidungsprozesse und die nachfolgende Umsetzung der Vereinbarungen (mit konkreten Handlungen und Fristen) erfolgen sollen.
- Bei manchen kooperativen Aushandlungsprozessen ist eine Festlegung, wer zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form die Umsetzung der Vereinbarungen prüft (Erfolgskontrolle), als eigener Punkt in den Vereinbarungen enthalten. Manchmal wird dazu ein Prüfgremium aus dem Kreis der Beteiligten eingerichtet.
Nachbereitung
- Nach dem Aushandlungsprozess ist es ratsam, dass die Verantwortlichen, die Beteiligten und die Moderator:innen die Veranstaltung (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung) kurz reflektieren: Was hat gut funktioniert? Was könnte beim nächsten Mal verbessert werden? Wie sieht die weitere Vorgangsweise aus?
- Sie sollten die Ergebnisse des Aushandlungsprozesses und die weiteren Schritte zur Umsetzung der Ergebnisse mit den Beteiligten und der Öffentlichkeit teilen.
7.3 Was passiert mit den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses?
- Für die Umsetzung der Ergebnisse sind meist unterschiedliche Institutionen zuständig, daher ist eine intensive Kommunikation beim Übergang vom Verfahrensabschluss zur Umsetzung wichtig, um Probleme zu vermeiden.
- Personen und Institutionen, die für die Umsetzung verantwortlich sind, sollten rechtzeitig, d. h. bereits in Schritt 5 in den Prozess einbezogen werden.
- Für die Umsetzung und Kontrolle der Ergebnisse werden manchmal eigene Gremien gebildet, deren Zusammensetzung und Aufgaben während des Beteiligungsverfahrens festgelegt werden, um eine kontinuierliche Beteiligung sicherzustellen.
- Wenn das Verfahren zu einem positiven Ende gekommen ist, sollten die Ergebnisse und der Verfahrensabschluss im Rahmen eines informellen Ausklangs in angenehmer Umgebung gefeiert bzw. entsprechend gewürdigt werden.
7.4 Beteiligungsbeispiel: Ein klimafitter Hauptplatz
Der Aushandlungsprozess verläuft im Großen und Ganzen so, wie ihn die Prozessbegleiterin am Beginn skizziert hat. Aus den Einzelgesprächen kann sie wertvolle Informationen von jenen Personen mitnehmen, die von den Gemeindeverantwortlichen als „schwierig“ eingeschätzt wurden. Bei der ersten öffentlichen Informationsveranstaltung bringen die knapp 150 Teilnehmer:innen wertvolle Hinweise und Vorschläge ein. Viele Gemeindebewohner:innen machen auch vom digitalen Angebot Gebrauch und wirken so am Beteiligungsprozess mit.
Die Auswahl der Bürger:innen für das Forum funktioniert reibungslos, jüngere und ältere Menschen, je sechs Frauen und Männer aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, bringen sich konstruktiv ein. Das Forum besteht aus insgesamt knapp 20 Personen. Bei den insgesamt sieben Sitzungen des Forums treten auch immer wieder Konflikte zutage, die jedoch durch eine umsichtige Moderation gut bearbeitet werden, und durch den konstruktiven Willen der Beteiligten werden Lösungen gefunden, die von den Forumsmitgliedern gemeinsam getragen werden können.
Neben den inhaltlichen Lösungen für die Umgestaltung des Platzes einigen sich die Prozessbeteiligten auch darauf, dass die Gemeinde während der Umsetzung der Maßnahmen die Bürger:innen in einem Newsletter regelmäßig informiert und dass ein Jahr nach Fertigstellung der Maßnahmen eine Umfrage zur Zufriedenheit mit dem neuen Platz erfolgen soll.
Bei der letzten öffentlichen Informationsveranstaltung präsentieren die Forumsmitglieder einen Gestaltungsvorschlag für einen klimafitten Hauptplatz, der bis auf leichte Ergänzungen und Abänderungen große Zustimmung bei den knapp 120 Teilnehmer:innen findet. Auch der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag zu und erteilt der Leiterin des Umweltamtes und dem Leiter des Bauamtes den Auftrag, die nötigen Schritte für die Umsetzung der Maßnahmen zu veranlassen.
In einer letzten Sitzung des Forums reflektieren die Teilnehmer:innen im ersten Teil den Aushandlungsprozess und sammeln ihre Lernerfahrungen und Verbesserungsvorschläge, die die Prozessbegleiterin abschließend in einem kurzen Bericht an die Gemeinde zusammenfasst. Im zweiten Teil der Sitzung folgt ein feierlicher Abschluss mit einem großen Dank der Leiterin des Umweltamtes und des Bürgermeisters an alle Prozessbeteiligten und einem anschließenden gemeinsamen Ausklang.
Zwei Wochen danach treffen sich die beauftragten Büros, die Verantwortlichen der Gemeinde und die Prozessbegleiterin zu einer letzten Sitzung, in der sie den Prozess und auch die inhaltlichen Vorschläge noch einmal gemeinsam reflektieren und relevante Punkte für die nachfolgende Umsetzung festhalten.