8. Die Ergebnisse umsetzen
Nach Abschluss des Aushandlungsprozesses geht es darum, die Ergebnisse umzusetzen. Je nach der Größe Ihres Vorhabens erfolgen zunächst Detail- und Ausführungsplanungen. Dies bedeutet, dass vom Ende des Beteiligungsprozesses bis zum Beginn der konkreten (baulichen) Umsetzung mehrere Monate, bei größeren Vorhaben auch mehr als ein Jahr verstreichen können.
In der Umsetzungsphase ist es wichtig, dass Sie diejenigen, die am Aushandlungsprozess beteiligt waren, in regelmäßigen Abständen über den Stand der Dinge informieren. Es kommt häufig vor, dass manche Details nicht genau so realisiert werden können wie in der Aushandlungsphase angedacht. Dies kann mit örtlichen Gegebenheiten oder sich ändernden Rahmenbedingungen zu tun haben. Wichtig ist, dass diese Änderungen und die Gründe dafür transparent kommuniziert werden.
8.1 Probleme bei der Umsetzung
Bei vielen Verfahren hat sich gezeigt, dass der Beteiligungsprozess selbst zwar gut gelaufen ist, dass die Umsetzung der Ergebnisse dennoch nicht funktioniert und die Teilnehmer:innen letztlich unzufrieden zurückgeblieben sind. Dafür kann es mehrere Ursachen geben:
- Die Ziele der Beteiligung wurden zu Beginn und während des Prozesses nicht oder nicht ausreichend geklärt.
- Es wurde zu Beginn nicht ausreichend geklärt, welche Ergebnisse oder Produkte am Ende des Prozesses im Einzelnen genau vorliegen sollen.
- Es wurde zu Beginn nicht ausreichend geklärt, wie weit die Beteiligung reichen soll und wo die Grenzen der Beteiligung liegen.
- Es gab während des Prozesses nicht ausreichend Spielraum für nötige Kurskorrekturen (z. B, betreffend die Ziele, Inhalte, Beteiligten, die Spielregeln oder die Dauer des Prozesses).
- Es wurde nicht oder nicht ausreichend geklärt, wie es nach dem Ende des Aushandlungsprozesses weitergehen soll, wer für die Umsetzung der Ergebnisse zuständig ist, wie die Umsetzung in späterer Folge überprüft werden soll etc.
- Unzureichende Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit während der Umsetzung. Ursachen dafür sind oftmals eine Änderung der Zuständigkeiten (z.B. von der Planungs- zu Bauabteilung), ein mangelndes Bewusstsein, wie wichtig die Kontinuität der Kommunikation ist und in der Folge die fehlende Bereitstellung der nötigen Ressourcen.
Hinweise dazu, wie Sie derartige Probleme und Schwierigkeiten gut vermeiden können, finden Sie unter Schritt 5.
8.2 Good-Practice Beispiele
Hier finden Sie erfolgreiche Beispiele, wo mithilfe von Bürger:innenbeteiligung Klimawandelanpassungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Weitere Anwendungsbeispiele zu Beteiligungsprojekten finden Sie z. B. unter partizipation.at und zu Klimawandelanpassungsprojekten z. B. unter klimawandelanpassung.at oder klar-anpassungsregionen.at.
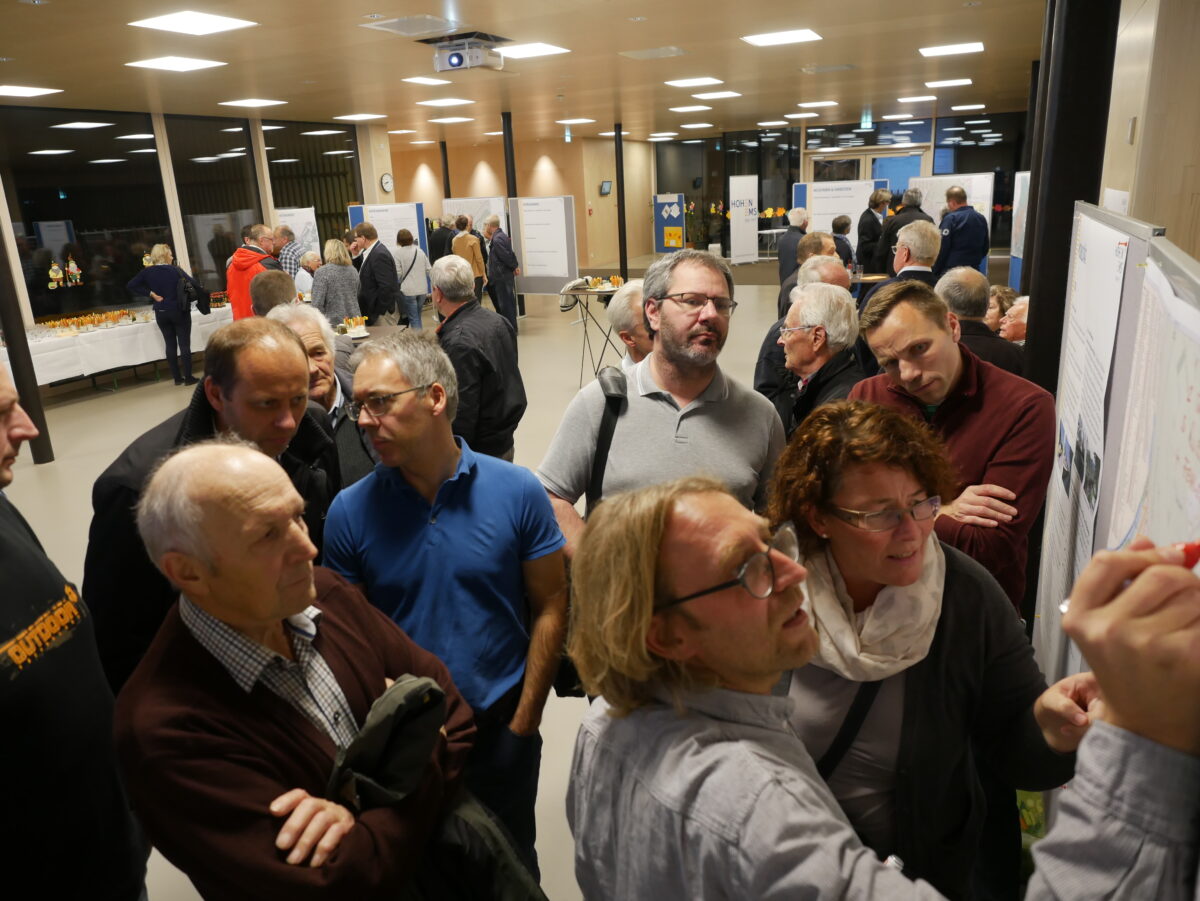
Stadt Hohenems
Bürger:innenbeteiligung im Rahmen des räumlichen Entwicklungskonzepts
Das räumliche Entwicklungskonzept für Hohenems wurde unter Einbeziehung der Bevölkerung erarbeitet. Im Rahmen von vier Stadtteilgesprächen (Ende 2017) konnten Bürger:innen ihre Ideen und Vorstellungen dazu einbringen. Zusätzlich konnten sich Bürger:innen über eine Online-Feedbackabfrage beteiligen.
| Dauer | Sechs Monate | |
| Beteiligungsmethoden |
|
|
| Ziele und Nutzen | Einerseits ist das Ziel, durch den Einbezug der Bevölkerung und Informationen über den Planungsprozess die Transparenz sowie dadurch auch die Akzeptanz von Planungen zu fördern. Andererseits soll dadurch auch lokales Wissen genutzt werden und auf konkrete Bedürfnisse in den jeweiligen Stadtteilen eingegangen werden. | |
| Schlüsselergebnisse |
|
|
| Herausforderungen und Lösungen |
|
|
| Wichtige Lernerfahrungen |
|
|
| Kontakt | Gernot Burtscher (Energie- und Klimabeauftragter, Stadt Hohenems) gernot.burtscher@hohenems.atDaniel Latzer (Leitung Stadtplanung und Umwelt, Stadt Hohenems) daniel.latzer@hohenems.at |

Stadtgemeinde Gmunden
Bürger:innenbeteiligung als Teil der Klimapolitik
Das bestehende Beteiligungsmodell wurde eingesetzt, um Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der Politik, der Verwaltung und der Bevölkerung zu verankern. Über die Einberufung eines Klimarates und die Entwicklung der Klimastrategie wurde eine generelle Kultur der Beteiligung etabliert. Das Engagement wird über vielseitige interaktive Formate am Leben gehalten.
| Dauer | Seit 2022 | |
| Beteiligungsmethoden |
|
|
| Ziele und Nutzen | Ziel der partizipativen Entwicklung der Klimastrategie war es, die Thematik auf ein breites, tragfähiges Fundament zu stellen. Dadurch wird dem Gemeinderat vermittelt, dass die Bevölkerung zu vielseitigen Klimaschutzmaßnahmen bereit ist und diese aktiv einfordert. Die Bevölkerung hat einen wirksamen Kanal, um ihre Anliegen bei den politischen Vertreter:innen zu Gehör zu bringen. | |
| Schlüsselergebnisse |
|
|
| Herausforderungen und Lösungen |
|
|
| Wichtige Lernerfahrungen |
|
|
| Kontakt | Verena Pühringer-Sturmayr (Klimakoordinatorin, Stadtgemeinde Gmunden) Verena.Puehringer-Sturmayr@gmunden.ooe.gv.at
Ulrike Feichtinger (Vizebürgermeisterin, Stadtgemeinde Gmunden) |
|
| Weitere Informationen | Beteiligungsmodell mitgestalten.gmunden.at Praxisbeispiel Gmunden: Entwicklung der Klimastrategie 2030 Klimastrategie, Klimarat und Jahresbericht der Klimastrategie Klimaschutzpreis |

Stadtgemeinde Tulln
1.000 Ideen für den Nibelungenplatz
Die Stadtgemeinde Tulln startete im April 2021 einen breit angelegten Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Nibelungenplatzes. Bürger:innen konnten ihre Ideen einbringen, diese wurden von Planungsbüros in unterschiedlichen Größenordnungen eingearbeitet. Dazu konnten Beteiligte in öffentlichen Veranstaltungen Feedback geben und nach weiteren Überarbeitungen in einer Volksbefragung für ihren bevorzugten Planungsentwurf stimmen.
| Dauer | Neun Monate | |
| Beteiligungsmethoden |
|
|
| Ziele und Nutzen | Ziel der Beteiligung war es, Ideen der Bürger:innen zu sammeln und einen Planungsentwurf zur Umgestaltung des Platzes zu entwickeln, der die Interessen und Wünsche der Bürger:innen berücksichtigt. Außerdem sollte ein Bewusstsein für klimafitte Entwicklungen geschaffen werden und ein attraktiver öffentlicher Raum zur gemeinschaftlichen Nutzung entstehen. Basierend auf der Abstimmung der Bürger:innen wurde der beliebteste Planungsentwurf umgesetzt. | |
| Schlüsselergebnisse |
|
|
| Herausforderungen und Lösungen |
|
|
| Wichtige Lernerfahrungen |
|
|
| Kontakt | Dr. Cornelia Hebenstreit (Abteilung Straßen und Verkehr, Stadtgemeinde Tulln) cornelia.hebenstreit@tulln.gv.at |
|
| Weitere Informationen | Projektinformationen der Stadtgemeinde tulln.at/aktuelles/nibelungenplatz-beteiligungs-und-planungsprozess |

Stadt Innsbruck
COOLYMP – klimafitte Platzgestaltung des DDr.-Alois-Lugger-Platz in Innsbruck
COOLYMP setzt sich aus den Wörtern „COOL“, für kühl, klimafit und attraktiv für Jung und Alt, und „OLYMP“, für das Olympische Dorf, einen peripheren Stadtteil Innsbrucks, zusammen. Gemeinsam mit den Bewohner:innen soll ein neuer Treffpunkt im Stadtteil Olympisches Dorf geschaffen werden. Dabei stehen die Planung und Umsetzung eines zukunftsgerichteten und klimafitten Platzes unter Einbindung der Wünsche und Ideen der Bewohner:innen im Fokus.
| Dauer | Drei Jahre | |
| Beteiligungsmethoden |
|
|
| Ziele und Nutzen | Ziel des Projekts ist eine klimafitte Platzgestaltung in einem kooperativen Planungsverfahren, das die Bedürfnisse aller beteiligten Anwohner:innen und Stakeholder:innengruppen berücksichtigt und – durch mehrmalige Rückkoppelungsschleifen – auch auf politischer Ebene auf breite Akzeptanz trifft.
Außerdem sollen durch die Reduktion der Oberflächentemperatur den Einsatz von grün-blauer Infrastruktur der gesamte Stadtteil aufgewertet und die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Das Projekt fungiert auch als Initialzündung für Kooperationen und weitere Bespielungen der angrenzenden Areale. |
|
| Schlüsselergebnisse |
|
|
| Herausforderungen und Lösungen |
|
|
| Wichtige Lernerfahrungen |
|
|
| Kontakt | Lukas Weiss, Referat BürgerInnenbeteiligung und partizipative Stadtgestaltung, Stadt Innsbruck lukas.weiss@innsbruck.gv.at Christine Schermer, Amt Klimaneutrale Stadt, Projektleitung COOLYMP, Stadt Innsbruck |
|
| Weitere Informationen | Innsbruck informiert | COOLYMP ibkinfo.at/dossier/coolymp COOLYMP wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds im Rahmen des Programmes „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“ gefördert. |
