Neues ElWG und EnDG – Zusammenfassung der für Energiearmut relevanten Passagen
07.07.2025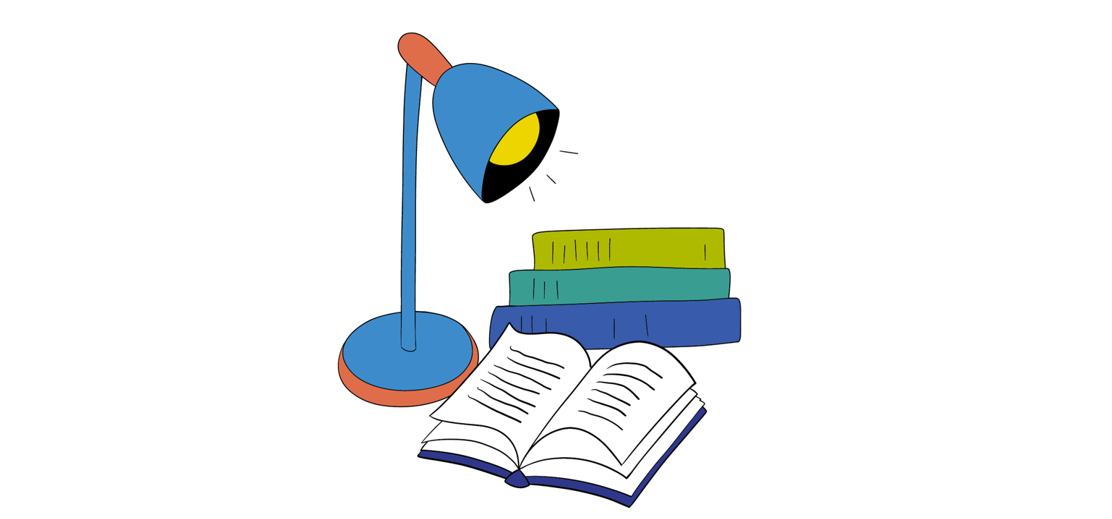
Neues ElWG und EnDG
Am 04.07.2025 startete die Begutachtungsfrist für das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) – ein zentraler Gesetzesentwurf, der zahlreiche Regelungen enthält, die direkt energiearmutsbetroffene Haushalte betreffen. Dazu zählen unter anderem:
- Pflichten der Energieversorger, z.B. bei Rechnungen, Mahnungen und Abschaltungen
- Rechte von Kund:innen, z.B. auf Ratenzahlung und Lieferantenwechsel
- der geplante Sozialtarif für einkommensschwache Haushalte
Ebenfalls in Begutachtung ist das Energiearmutsdefinitionsgesetz (EnDG), das künftig erstmals einen gesetzlichen Rahmen zur Definition und Erhebung von Energiearmut schaffen soll.
Diese Gesetzesvorhaben setzen wichtige Weichen für die kommenden Jahre. Umso bedeutender ist es, dass Organisationen und Personen, die sich im Bereich Energiearmut engagieren, ihre Perspektive einbringen. Eine Stellungnahme ist bis 15.08.2025 möglich!
Hier geht es zu den vollständigen Gesetzesentwürfen und der Möglichkeit zur Stellungnahme.
Zusammenfassung der für Energiearmut relevanten Passagen
Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG)
Das neue ElWG regelt zahlreiche Aspekte im Strombereich, die für von Energiearmut betroffene oder bedrohte Haushalte relevant sind – z.B. rund um die Versorgungssicherheit, Zahlungsmodalitäten, Transparenz und Verbraucher:innenschutz bis hin zum Sozialtarif.
Die relevantesten Paragraphen im Überblick:
- Begünstigte Haushalte (d.h. ORF-Beitragsbefreite Personen, die i) Pflegegeld oder eine vergleichbare Leistung beziehen, ii) Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder vergleichbare wiederkehrende Leistungen beziehen, oder iii) Leistungen aus der Sozialhilfe, freien Wohlfahrtspflege oder sonstigen öffentlichen Mitteln wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit beziehen) haben gegenüber allen Stromlieferanten Anspruch auf einen gestützten Preis (Sozialtarif). Dieser liegt für ein Verbrauchskontingent von max. 2.900 kWh/Jahr bei 6ct./kWh und wird ab Jänner 2027 (entsprechend der Erhöhung der Pensionen) valorisiert. Strommengen, die aus gemeinsamer Energienutzung bezogen werden, werden auf das Kontingent angerechnet. Für jede vierte und weitere Person im Haushalt ist eine zusätzliche Pauschale von 52,50€ jährlich vorgesehen. Das Ministerium kann per Verordnung zukünftig auch eine Pauschale für Personen aus begünstigten Haushalten mit stromintensiven medizinischen Geräten erlassen. Für Stromverbräuche über das Kontingent hinaus darf der Preis nicht höher sein als ein oberer Referenzwert, der sich an Börsenentwicklungen orientiert und am Ende eines jeden Quartals von der E-Control berechnet und veröffentlicht wird. (§36 Gestützter Preis für begünstigte Haushalte, §37 Bestimmungen für Lieferverträge mit gestütztem Preis)
- Die ORF-Beitrags Service GmBH (OBS) hat den jeweiligen Lieferanten unverzüglich nach der Befreiung vom ORF-Beitrag über die jeweiligen Kund:innen zu informieren. Der Lieferant muss den gestützten Preis ab dem folgenden Monat berücksichtigen und gesondert auf der Rechnung ausweisen. Bei einem Lieferantenwechsel muss die OBS auf Verlangen des Haushalts erneut die Information an den neuen Lieferanten übermitteln. Lieferanten können Nachweise über die Voraussetzungen verlangen, wenn sie die Richtigkeit der Angaben bezweifeln. Fallen die Voraussetzungen für die ORF-Gebührenbefreiung weg (z.B. durch Verbesserung der Einkommenssituation), entfällt auch die Anspruchsberechtigung für den gestützten Preis (§36 Gestützter Preis für begünstigte Haushalte, §37 Bestimmungen für Lieferverträge mit gestütztem Preis, Erläuterungen zu §36)
- Für die durch den gestützten Preis entstehenden Kosten müssen alle Lieferanten in Österreich bis zu 50. Mio. € jährlich gemeinschaftlich gemäß eines Verteilungsschlüssels aufbringen. Dafür erhalten sie eine Pauschale von 67,20€ pro beliefertem begünstigten Haushalt und Jahr, welche per Verordnung des Ministeriums angepasst werden kann. Die Weiterverrechnung von dadurch bereits abgegoltenen Kosten an Haushaltskund:innen ist unzulässig. (§37 Bestimmungen für Lieferverträge mit gestütztem Preis)
- Zur Prüfung der von den Lieferanten kommunizierten Kosten, der Verbrauchskontingente und weiterer Informationen im Zusammenhang mit dem gestützten Preis wird eine Abwicklungsstelle eingerichtet. Diese übernimmt die anteilige Zuordnung der Kosten an die Lieferanten und verrechnet allfällige Differenzbeträge den Lieferanten bzw. dem Bund. Sie untersteht dem BMWET Minister und veröffentlicht jährlich einen Bericht (§37a, §37b).
- Falls Haushalte eine Nachzahlung leisten müssen, müssen Netzbetreiber und Lieferanten eine Ratenzahlung ermöglichen – in begründeten Fällen mit bis zu 18 Monaten Laufzeit. Bei Monatsrechnungen ist eine Laufzeit von bis zu 6 Monaten möglich. Die konkrete Dauer dürfen Kund:innen selbst bestimmen. Eine frühere, teilweise Rückzahlung ist jederzeit möglich. (§28 Recht auf Ratenzahlung)
- Größere Lieferanten müssen Anlauf- und Beratungsstellen einrichten, die u.a. zu Leistbarkeit, Lieferantenwechsel und Energiearmut beraten. Die Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail) – inkl. jener von Anspruchspersonen für soziale Einrichtungen zur Klärung von Härtefällen – müssen auf ihrer Website leicht auffindbar sein. Kund:innen haben ein Recht auf gutes Service und einfaches, zügiges Beschwerdemanagement. (§35 Anlauf- und Beratungsstellen)
- Haushalte haben das Recht auf einen Prepayment-Zähler. Dadurch dürfen ihnen keine Nachteile entstehen. Neu: Schutzbedürftigen Haushalten dürfen für Einbau, Nutzung etc. keine Kosten auferlegt werden. (§29 Recht auf Vorauszahlungszähler)
- Bei Zahlungsverzug müssen Netzbetreiber vor Abschaltung der Verbindung mindestens zwei Mahnungen mit zweiwöchiger Nachfrist aussprechen – die letzte Mahnung mittels eingeschriebenem Brief. Auf das Recht auf Ratenzahlung, Wechsel, den Tarifkalkulator und Anlauf- und Beratungsstellen ist hinzuweisen. Die Musterformulierung dafür verfasst die E-Control. Abschaltungen dürfen nicht am Tag vor Wochenenden oder Feiertagen vorgenommen werden. (§ 34 Abschaltung der Netzverbindung)
Weitere relevante Paragraphen beinhalten:
- Kund:innen dürfen ihre Stromlieferanten frei wählen und ohne zusätzliche Kosten (unter Einhaltung von Bindungsfristen) wechseln. Darauf müssen Lieferanten auch einmal jährlich hinweisen. Sofern Lieferanten zu diesem Zeitpunkt über ein günstigeres Produkt verfügen als das aktuell vereinbarte, müssen sie den Kund:innen einen Umstieg anbieten (§19 Recht auf freie Lieferantenwahl, §24 Kündigungsfristen, §25 Recht auf Lieferantenwechsel)
- Tarifkalkulator: Die E-Control hat dieses kostenlose Vergleichsinstrument zu betreiben und dabei eine benutzerfreundliche, klare und leicht verständliche Darstellung der Ergebnisse sicherzustellen (§27 Instrument für den Vergleich).
- Lieferanten müssen Kund:innen ein knappes, leicht verständliches Informationsblatt über wesentliche Vertragsbestandteile zur Verfügung stellen (z.B. über Produktbezeichnung, Energiepreis, etwaige Zuschläge und Abgaben, Bindungsfristen, etwaige vereinbare Rabatte bzw. Dauer von Preisgarantien, Modus bei Preisänderungen etc.) (§20 Allgemeine Lieferbedingungen, v.a. Abs. 3)
- Zukünftig ist bei Neuabschluss von Verträgen die elektronische Kommunikation Standard, z.B. per E-Mail oder Webportal. Diese Vereinbarung kann von Kund:innen jederzeit widerrufen werden, dann gilt die Kommunikation in Papierform als vereinbart. (§18 Elektronische Kommunikation)
- Rechnungen für Strom und Netzgebühren müssen transparent und leicht verständlich sein. Auf Wunsch muss der Kund:in klar und verständlich erläutert werden, wie die Rechnung zustande gekommen ist. (§39 Mindestanforderungen an Rechnungen) Der Rechnung ist mind. 1x jährlich ein Informationsblatt beizulegen, in dem u.a. auf das Recht auf Ratenzahlung, Nutzung von Prepaymentmetern usw. hingewiesen wird. Dabei sind Musterformulierungen der E-Control zu verwenden. (§43 Sonstige Informationen) Kund:innen mit Smart Meter dürfen zwischen monatlichen und jährlichen Rechnungen wählen und sind entsprechend zu informieren. (§40 Abrechnungszeitraum)
- Änderungen bei den Lieferbedingungen, z.B. bei den Entgelten, müssen Kund:innen mind. 1 Monat im Vorhinein schriftlich mitgeteilt und begründet werden und dem jeweiligen Anlass angemessen sein. Bei Wegfall des Anlasses für eine Entgelterhöhung muss eine entsprechende Entgeltsenkung stattfinden. (§21 Änderungen der Lieferbedingungen)
- Alle Haushalte dürfen sich auf Grundversorgung berufen – Netzbetreiber und Lieferanten sind dann verpflichtet, sie zu beliefern. Es darf dabei keine Vorauszahlung verlangt werden, die höher als ein monatlicher Teilzahlungs- oder Rechnungsbetrag ist. Bei (erneuter) Zahlungsunfähigkeit in der Grundversorgung, kann sich ein Haushalt zur Vorauszahlung mittels Prepaymentmeter verpflichten, um eine Abschaltung durch den Netzbetreiber zu verhindern. (§30 Recht auf Grundversorgung)
- Netzbetreiber müssen Kund:innen mit Smart Meter ausstatten, die den Verbrauch in 15-Minuten-Intervallen messen und speichern können. Kund:innen müssen diese Werte abrufen können. (§44 Ausstattung, §45 Anforderungen, §47 Verfügbarkeit)
- Wenn eine Gebietskörperschaft mit einer Stromerzeugungsanlage, die im Eigentum der Gemeinde steht, an einer gemeinsamen Energienutzung teilnimmt, dann muss die Gebietskörperschaft sicherstellen, dass schutzbedürftigen Haushalten mind. 10% der jährlich erzeugten und eingespeisten Strommenge zur Verfügung steht. (§61 Abs. 7)
- Netzentgelte werden von der E-Control festgelegt und sollen Anreize für einen systemdienlichen Betrieb setzen. (§119 Bestimmung der Systemnetzungsentgelte, §120 Netznutzungsentgelt)
Energiearmutsdefinitionsgesetz (EnDG)
Das neue Energiearmutsdefinitionsgesetz legt erstmals einen verbindlichen Rahmen zur Definition und statistischen Erhebung von Energiearmut in Österreich fest. Es definiert, wann ein Haushalt als energiearm gilt und ist somit eine wichtige Grundlage für gezielte Maßnahmen, Förderungen und politische Entscheidungen
Die relevantesten Paragraphen im Überblick:
- Definition: Als energiearm gelten jene Haushalte, die die notwendigen Mittel für Ausgaben für Haushaltsenergie für ein grundlegendes und angemessenes Maß an Lebensstandard und Gesundheit nicht oder nur unzureichend selbst aufbringen können. (§4 Definition)
- Für die Messung von Energiearmut können verschiedene Indikatoren herangezogen werden, (z.B. armutsgefährdete Haushalte mit gleichzeitig überdurchschnittlichen Energiekosten oder gleichzeitig besonders niedrigen Energiekosten, Haushalte, die Wohnräume nicht angemessen warmhalten können, oder armutsgefährdete Haushalte deren Wohnräume von schlechter Bausubstanz gekennzeichnet sind etc.) – diese Indikatoren können u.a. unter Berücksichtigung des kea Jahresberichts angepasst und ergänzt werden. (§5 Indikatoren)
- Die Statistik Austria hat alle zwei Jahre statistische Analysen zu Energiearmut zu veröffentlichen, wobei u.a. auch Empfehlungen von E-Control und kea zu berücksichtigen sind. (§6 Analysen)
- Für Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut bzw. zur Förderung klimarelevanter Investitionen beschreibt das Gesetz Möglichkeiten zur Feststellung der Unterstützungswürdigkeit. Es unterscheidet dabei zwischen “schutzbedürftigen / einkommensschwachen” und “förderungswürdigen” Haushalten und sieht für beide Gruppen unterschiedliche Einkommensschwellen und Förderoptionen vor. (§7 Unterstützungswürdige Haushalte) Als Nachweis der Unterstützungswürdigkeit gilt u.a. die Befreiung des ORF-Beitrags, der Erhalt einer Ausgleichszulage (Mindestpension), oder auch der Erhalt von Leistungen aus Wohnbeihilfe, Sozialhilfe oder sonstigen öffentlichen Mitteln wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit – bzw. bei Nichtvorliegen solcher Nachweise der Nachweis durch einen Transparenzdatenbankauszugs durch Förderabwicklungsstellen, oder den Nachweis eines ausreichend niedrigen Haushaltseinkommens durch Prüfung über die ORF-Beitrags Service GmbH (§8 Nachweis der Unterstützungswürdigkeit, §9 Prüfung der Einkommen, §10 Verfahren).
Neugierig geworden?
Das Ministerium hat die Vorteile des neuen ElWG für Haushalte hier zusammengefasst. Weitere relevante Gesetze und Rechtsrahmen hat die kea bereits 2024 bei ihrem zweiten Interdisziplinären Forum zur Bekämpfung von Energiearmut beleuchtet. Die Nachlese dazu finden Sie hier:
